
»Ich hoffe, dass ich es irgendwann vergessen kann.«
Elke Schlegel wird am 20. Februar 1958 in Jena geboren. Im Frühjahr 1961 zieht ein Teil der Verwandtschaft in den Westerwald. Elke und ihr Vater besuchen sie in der Bundesrepublik, wo ihr Vater am liebsten bleiben möchte. Doch Elkes Mutter ist zum zweiten Mal schwanger und will nicht umziehen, darum kehren Elke und ihr Vater zurück in die DDR. Als im Dezember 1961 Elkes Bruder zur Welt kommt, ist die innerdeutsche Grenze lückenlos abgeriegelt.
Elke übernimmt schon in jungen Jahren viel Verantwortung. In der Flaschenbierhandlung, die ihre Mutter als selbstständige Kommissionärin für die Handelsorganisation (HO) der DDR betreibt, muss Elke mithelfen.
Elke mag die Schwerpunkte der schulischen Erziehung nicht. Sie möchte Englisch lernen statt »Einführung in die sozialistische Produktion« oder Staatsbürgerkunde.
»Die Pioniernachmittage schwänzte ich oft. Dann wurde man Montagsmorgens in der Schule zum Fahnenappell vorgerufen und vor 600 Schülern öffentlich getadelt. Das war schon peinlich.«
Als ihre Mutter ihr die Christenlehre verbietet, geht sie heimlich. Die Konfirmation darf sie nicht mitmachen.
»Ich musste diese sozialistische Jugendweihe über mich ergehen lassen. Und da war dieser blöde Spruch: »Ab heute werden Sie in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen und die Welt steht Ihnen offen.« Da saß ich und dachte: Was für eine Lüge. Ich fing an, zu hinterfragen.«
Nach Abschluss der 10. Klasse möchte Elke Dekorateurin werden. Doch wegen der staatlichen Lenkung der Arbeitskräfte in der DDR bekommt sie eine Ausbildung im Interhotel in Jena. Die Hotelkette ist eine gehobene Klasse, in denen die DDR bevorzugt Gäste aus dem sozialistischen Ausland empfängt. Elke hat Freude am Kontakt mit den Gästen und kann ihr Englisch auffrischen. Mit einer Freundin fährt sie viel in den Urlaub.
»Ich war in der Tschechei, in Polen, in Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn. Und da war Schluss. Da war die Welt für uns zu Ende.«
1976 schließt sie ihre Lehre mit guten Noten ab. Elke bewirbt sich als Schiffsstewardess und Flugbegleiterin. Aufgrund ihrer Westverwandtschaft werden die Bewerbungen abgelehnt. Die 18-Jährige arbeitet weiterhin im Interhotel, wo ihr täglich Klassenunterschiede vor Augen geführt werden.
»Hier gab es Rinderfilet, Châteaux Briand, Edelgemüse. Es gab Blumenkohl, grüne Bohnen und Blattsalat. Es war alles da, was die normale Bevölkerung nicht kriegte.«
Mit 21 lernt Elke Thomas kennen. Schnell wird aus den beiden Verliebten ein unzertrennliches Paar. Weil sie nicht aufgeklärt wurde, merkt Elke erst spät, dass sie schwanger ist. Der Gynäkologe bietet ihr eine Abtreibung an, obwohl sie längst über den dritten Monat hinaus ist. Elke weiht nun Thomas ein, der sich überglücklich zeigt. Am 23. Juni 1981 entbindet Elke ihren gemeinsamen Sohn Tony in der Frauenklinik Jena. Ein hochemotionales Ereignis, das sie völlig allein bewältigen muss. Thomas darf sein Kind erst am Abend besuchen. Ihre Mütter kommen nicht.
Bei der Namensgebung erwartet sie eine unangenehme Überraschung. Sie dürfen den Namen ihres Sohnes nicht in der Schreibweise mit »y« in die Geburtsurkunde eintragen lassen, denn diesen Buchstaben gibt es im Sprachschatz der DDR angeblich nicht.
Die ersten Wochen zu Hause sind enorm anstrengend und belastend für die kleine Familie, die beengt in Elkes Kinderzimmer wohnt und darüber hinaus jeden Tag mit der Missbilligung von Elkes Mutter konfrontiert ist. Doch all ihre Bemühungen, auszuziehen, scheitern. Als unverheiratetes Paar haben Elke und Thomas keine Chance bei der staatlichen Wohnungsvergabe.
Kurzerhand richten sie sich in einem stillgelegten Altstoffhandel eine Wohnung her. Doch nach drei Monaten werden sie der Wohnraumbesetzung angeklagt und verlieren den Prozess. Neben der nun täglich drohenden Zwangsräumung sorgt sich Elke auch um die Zukunft ihres Sohnes.
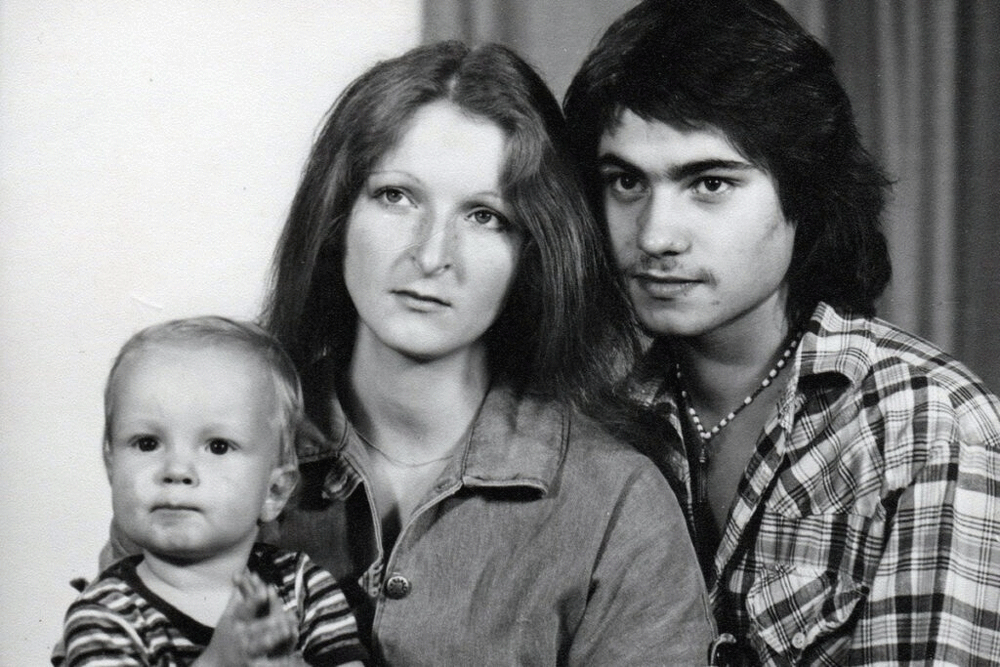
Elke, Thomas und ihr Sohn, 1982
»Als Junge wird er zur NVA gezogen. Dort gibt es einen Schießbefehl. Vielleicht muss er an die Grenze und irgendwelche Menschen umbringen. Dann wird er zum Mörder. Wir können den nicht beschützen. Wir wollten für unseren Sohn eine bessere Zukunft.«
Mit ihrer Einstellung fühlen sie sich zur Jungen Gemeinde der evangelischen Kirche hingezogen und treffen sich regelmäßig in getarnten Partykellern mit Gleichgesinnten. Doch die alltäglichen Konfrontationen, Repressionen und Verbote erschöpfen Elke und Thomas. Sie passen nicht ins typische Bild der DDR und leben in wilder Ehe. Westjeans und Parka sind ungern gesehen, westliche Musik verboten, Bücher bestimmter Autoren verbannt.
Im Interhotel will man die Belegschaft verpflichtend in der DDR-Massenorganisation Deutsch-Sowjetische Freundschaft  DSF unterbringen. Elke lehnt die Mitgliedschaft genauso ab wie das Wählen, das in der Praxis eben nicht frei und geheim stattfindet. In der Konsequenz gibt es für sie auf der Arbeitsstelle niemals Prämien oder Auszeichnungen. Elke lernt, klar zwischen ihrer öffentlichen und der privaten Meinung zu unterscheiden. Sie fühlt sich der elementarsten Menschenrechte beraubt.
DSF unterbringen. Elke lehnt die Mitgliedschaft genauso ab wie das Wählen, das in der Praxis eben nicht frei und geheim stattfindet. In der Konsequenz gibt es für sie auf der Arbeitsstelle niemals Prämien oder Auszeichnungen. Elke lernt, klar zwischen ihrer öffentlichen und der privaten Meinung zu unterscheiden. Sie fühlt sich der elementarsten Menschenrechte beraubt.
»Es war die Reisefreiheit eingeschränkt, die Meinungsfreiheit, meine Religionsfreiheit. Meine Berufswahl war mir verwehrt worden. Wir bekamen nicht mal eine Wohnung. In jeder Gaststätte musste man verdammt aufpassen, was man erzählte. Für so einen blöden politischen Honecker-Witz wurde man ja verhaftet. Wir hatten die ganzen Schikanen satt. Wir saßen auf einer Bombe, die jeden Tag explodieren konnte.«
Elke und Thomas wollen die DDR verlassen. Als Elkes westdeutscher Cousin sie im Sommer 1983 besucht, fragen sie ihn aus. Sie wollen ihre Chancen auf Arbeit und eine gemeinsame Wohnung abklären und wissen, wie es mit der Schulbildung oder der Reise- und Religionsfreiheit im Westen aussieht. Für das Paar steht schnell fest, dass es auf keinen Fall illegal fliehen möchte, um sich und das Kind zu schützen.
Im September 1983 stellen sie einen Ausreiseantrag und werden damit Teil einer Bewegung, die wesentlich zum Zusammenbruch der SED-Diktatur beiträgt. Insgesamt über 400.000 Antragsteller dürfen in die Bundesrepublik übersiedeln.
Gesetzlich ist eine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR nicht vorgesehen. Elke und Thomas berufen sich auf das Recht auf Freizügigkeit, das Erich Honecker 1975 mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki den DDR-Bürgern zusichert. Antragsteller zahlen oft den hohen Preis von langwierigen Repressionen auf persönlicher, familiärer und beruflicher Ebene.
Das erfahren auch Elke und Thomas. Beide werden auf der Arbeitsstelle degradiert. Deut-lich schlimmer wiegen die Schikanen des Kindergartens. Sie wird von Thomas‘ Tante aus Westberlin mit Wegwerfwindeln unterstützt. Doch die Erzieher weigern sich, das Produkt aus dem »kapitalistischen Ausland« zu verwenden und lassen Tony so lange in feuchten Windeln liegen, bis er furchtbar wund ist.
Elke sieht keine andere Möglichkeit, als sich in den Spätdienst versetzen zu lassen. Ab sofort betreut sie ihren Sohn tagsüber, Thomas übernimmt dann nach seinem Arbeitsschluss. Weil in ihnen die Sorge wächst, einmal getrennt zu werden, will das Paar heiraten. Doch nach der Vorlage ihres PM 12 erhalten sie nicht einmal einen Termin auf dem Standesamt.
In der Absicht, ihre Verwandten vor der Sippenhaft zu schützen, möchte Elke sich von ihnen lossagen. Die Familie reagiert sehr unterschiedlich auf den Ausreiseantrag. Während ihre Mutter so wütend ist, dass sie Elke ohrfeigt und ihr vorwirft, sie mache ihr das Geschäft kaputt, möchte ihr Vater mitkommen und bittet sie, ihm ebenfalls einen Antrag zu formulieren. Auch Elkes Bruder möchte mit ausreisen. Seine schwangere Freundin will allerdings die Geburt des Kindes abwarten. Kurz darauf wird ihr Bruder zur Nationalen Volksarmee  NVA gezogen und bei der Bereitschaftspolizei in Rudolstadt eingesetzt.
NVA gezogen und bei der Bereitschaftspolizei in Rudolstadt eingesetzt.
Obwohl ab Anfang der 1980er-Jahre Zehntausende DDR-Bürger Ausreiseanträge stellen, kommt es nur selten vor, dass sich Antragsteller untereinander solidarisieren oder gar organisieren. Viele verhalten sich lieber so unauffällig wie möglich. Eine Ausnahme ist jedoch der Jenaer Weiße Kreis. Eine Protestgruppe, die ihre Anträge auf Ausreise öffentlich machen will. Als stilles und doch für jedermann sichtbares Erkennungszeichen stellen Elke und Thomas eine weiße Friedenstaube ins Fenster und tragen ein weißes Armband am Handgelenk.
An jedem Dienstag, dem offiziellen Sprechtag, suchen sie den Rat der Stadt Jena auf und fragen nach, wie es mit der Bearbeitung ihres Ausreiseersuchens aussehe. Wiederholt wird der Antrag abgelehnt. Eine Begründung hierfür erhalten sie nie. Unbeirrt stellen sie jedes Mal einen neuen Antrag.
Und sie nehmen an den stummen Demonstrationen des Weißen Kreises teil. Dieser trifft sich ab dem Sommer 1983 regelmäßig am Samstagmorgen auf dem Platz der Kosmonauten in Jena. Die Anzahl der Personen, die sich an den Händen fassen und schweigend einen Kreis bilden, wächst beständig. Beim Ministerium für Staatssicherheit  MfS gilt der Weiße Kreis als »feindlich-negative Gruppierung rechtswidrig um Übersiedlung ersuchender Personen im Bezirk Gera«. Die Teilnehmer des Weißen Kreises werden von der Stasi durch ständige Überwachung und Verhöre unter Druck gesetzt, ein Großteil sogar verhaftet.
MfS gilt der Weiße Kreis als »feindlich-negative Gruppierung rechtswidrig um Übersiedlung ersuchender Personen im Bezirk Gera«. Die Teilnehmer des Weißen Kreises werden von der Stasi durch ständige Überwachung und Verhöre unter Druck gesetzt, ein Großteil sogar verhaftet.
Auch Elke und Thomas werden wiederholt von der Arbeit, aus der Wohnung oder direkt von der Straße weggeholt und über mehrere Stunden hinweg verhört.
»Demonstrieren war verboten. Wir standen einfach schweigend da und fassten uns an den Händen. Aber das erregte in Jena schon Aufsehen. Und dann wurde versucht, das zu unterbinden.«
Auch am 10. Dezember 1983, dem Tag der Menschenrechte, trifft sich die Gemeinschaft der Antragsteller. Mit einer brennenden weißen Kerze in der Hand stellen sie sich auf den Weihnachtsmarkt. Eine subtile Botschaft, mit der sie sich sicher fühlen. Doch die DDR-Behörden sehen das anders und schicken die Bereitschaftspolizei, um die Gruppe schnell und effektiv verhaften zu lassen.
»Das war mit das Schlimmste, was mir passierte: Mein Bruder stand uns gegenüber und musste uns verhaften. Das Gefühl, dass dein eigen Fleisch und Blut mit einem geladenen Maschinengewehr vor dir steht, kann man überhaupt nicht beschreiben.«
Um die »Störenfriede« loszuwerden, genehmigen die DDR-Behörden in Jena innerhalb weniger Monate eine hohe Anzahl von Ausreiseanträgen. Im März 1984 bedeutet man Elke und Thomas, die Bewilligung ihrer Anträge stünde unmittelbar bevor. Zu diesem Zeitpunkt haben sie ihr Ausreiseanliegen achtmal wiederholt. Hoffnungsvoll treffen sie alle Vorbereitungen.
Doch stattdessen werden sie am 28. März 1984 verhaftet. In den frühen Morgenstunden hämmert es vehement gegen ihre Wohnungstür. Im nächsten Moment ist das Schloss zertrümmert, fünf Männer in Zivil und eine uniformierte Frau stürmen die Wohnung. Elke und Thomas werden aufgefordert, sich anzuziehen und – wieder einmal – zur »Klärung eines Sachverhalts« mitzukommen.
Doch etwas ist anders, das spürt Elke genau. Nicht nur, dass dies ein außergewöhnlich hohes Aufgebot an Beamten ist. Weil Thomas zuerst abgeführt wird, kann Elke durchs Fenster sehen, dass das Auto nicht wie üblich stadteinwärts, sondern in Richtung Autobahn abfährt. Ihr mulmiges Gefühl wächst.
Sie zieht den zweieinhalbjährigen Tony an und will ihn in die Krippe bringen, doch die Beamtin verbietet dies. Stattdessen fährt man sie zu ihrer Mutter und klingelt diese wach, um den Sohn ihn ihre Obhut zu geben. Die Beamtin rückt Elke nicht von der Seite und ermöglicht nur wenige, hastige Sätze des Abschieds im Treppenhaus. Diese Bilder werden Elke Zeit ihres Lebens verfolgen.
»Ich sagte: »Mutti, kannst du bitte auf unser Kind aufpassen. Ich glaube, wir sehen uns nicht wieder.« Der Junge saß unten auf der Treppe, ich kniete mich zu ihm hin und sagte: »Ich geh dir was Schönes kaufen. Ich bin bald wieder da.« Das war der Abschied. Ich wollte ihn eigentlich noch umarmen und drücken, da zog die mich weg.«
Elke versucht mit größter Anstrengung, ihre Tränen zu unterdrücken, um der MfS-Beamtin keinen Triumph zu gönnen. Überwältigt von der Befürchtung, ihren Sohn nie wieder zu sehen, lässt Elke sich nach Gera abtransportieren.
In der dortigen Untersuchungshaftanstalt (UHA) der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit (BVfS) setzt man sie in ein fensterloses Verhörzimmer und vernimmt sie stundenlang. Zuerst wirft man ihr Republikflucht vor.
»Ich verstand es einfach nicht. Ich dachte, das wäre ein riesengroßer Irrtum. Wir haben nichts verbrochen. Die können uns nicht festhalten.«
Der MfS-Beamte brüllt, dann spricht er wieder in ruhigem Ton. Elke muss an der Wand stehen, dann wieder auf dem Hocker sitzen, die Hände unter den Oberschenkeln. Sie friert, hat Hunger und Durst und muss auf die Toilette. Der Stress bereitet ihr Kopfschmerzen, sie verliert das Zeitgefühl und die Konzentration. Immer wieder denkt sie an ihren Sohn. Dann ergreift sie die Panik und das Herz schlägt bis zum Hals. Der Vernehmer nutzt ihren Zustand aus und bearbeitet sie intensiver.
»Ich wollte nicht weinen, weil ich zu stolz war, denen zu zeigen, dass mir das alles wehtut, was die mit mir machen. Du lässt dich nicht kleinkriegen.«
Irgendwann am Abend ist das Verhör vorbei. Elke wird in einen anderen Bereich der Untersuchungshaftanstalt abgeführt, wo man sie als Häftling registriert und ihr dazu zunächst die Fingerabdrücke abnimmt. Um Fotos anzufertigen, setzt man sie auf einen Stuhl und schnallt ihre Arme daran fest. Dann richtet man ein grelles Licht auf sie und lässt sie allein. Hinter Elke hängt ein dicker schwarzer Vorhang. In Panik erinnert sie sich an den Schulausflug nach Buchenwald, wo man ihnen eine Genickschussanlage der Nazis zeigte, die hinter einem ähnlichen Vorhang versteckt war.
Kurz darauf wird Elke an eine barsche Wachhabende übergeben, vor der sie sich nackt ausziehen und an die sie ihre Kleidung, den Verlobungsring sowie das Foto ihres Sohnes abgeben muss. Dann erfolgt eine körperliche Untersuchung, die erniedrigender kaum sein könnte.
»Sie guckte in alle Löcher, die eine Frau hat. Das war so menschenunwürdig, so deprimierend. Ich wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher und hatte nichts gemacht. Dann musste ich splitterfasernackt über den Gang laufen, an männlichen Wachposten vorbei. Ich schämte mich so.«
Elke wird in eine Zelle gesperrt. Drei Monate gibt es nichts anderes als die Vernehmungen und das Sitzen und Warten. Der ständige Schlafman¬gel sowie Stress und Angst setzen ihr zu. Elke hat keinen Appetit und Bauchschmerzen. Die 26-Jährige magert ab.
»Für mich war das Schlimmste, dass sie mir mein Kind weggenommen hatten. Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht einfacher durch die ganze Sache gekommen, dann hätte ich nur auf mich aufpassen müssen.«
Immer wieder bittet Elke um Auskunft, wie es ihrem Sohn ergehe. Sie weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als in den Hungerstreik zu gehen. Doch man droht ihr eine Zwangsernährung an. Also fügt sie sich und isst wieder.
Nach den Vernehmungen fühlt sich Elke jedes Mal mehr gedemütigt, ausgelaugt und völlig erschöpft. Die MfS-Beamten drohen ihr, dass sie ihr Kind und Thomas niemals wieder sehen werde. Elke ist wütend, dass die Staatssicherheit über so viel Macht verfügt, sie für Verbrechen einzusperren, die sie gar nicht begangen hat.
Im Juni 1984 wird Elke wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme zu ihrem westdeutschen Cousin zu einem Jahr und sechs Monaten Strafvollzug verurteilt. Thomas erhält einen Monat weniger.
Wenige Tage später wird Elke ins sächsische Stollberg gebracht. Hoheneck, eine ehemalige Ritterburg, ist die zentrale Frauenhaftanstalt der DDR. In dem alten Gemäuer sperrt man bei beißender Kälte, mangelhafter Ernährung und harter Arbeit politisch Verurteilte mit kriminellen Schwerverbrecherinnen zusammen, um sie gezielt einzuschüchtern.
Elke wird einer Großzelle mit 42 Frauen zugeteilt. Es gibt eine strenge Ordnung fürs Bettenmachen, einen morgendlichen Zählappell. In der Zelle herrscht eine strenge Hierarchie und die sogenannte Verwahrraumälteste hat für die nötige Disziplin zu sorgen. Das Wach¬perso¬nal duldet Übergriffe mit kalter Gleichgültigkeit und führt selbst härteste Bestrafungen durch.
Elke lernt schnell, sich so unauffällig wie möglich zu benehmen. Um sexuellen Übergriffen zu entgehen, täuscht sie eine lesbische Beziehung mit einer Mitgefangenen vor. Dennoch bleibt die ständige Angst.
Privatsphäre existiert nicht. Ein großer Trog mit fünf Wasserhähnen, die nur eiskaltes Wasser führen, sowie zwei Toiletten müssen für alle 42 Insassinnen reichen. Zählappelle, Zellenrazzien und demütigende körperliche Untersuchungen gehören genauso zum Gefängnisalltag wie die Haftarbeit: Im Dreischichtsystem mit acht Stunden an sechs Tagen der Woche muss Elke Strumpfhosen-Rohlinge über ein 60 Grad heißes Eisen ziehen. Die Norm liegt bei 1.200 pro Tag. Das schafft Elke kein einziges Mal.
Von der gesundheitsschädlichen Arbeit bekommt sie Atemprobleme und Warzen an den Händen. Doch nach einem entsetzlichen Zahnarztbesuch während der Untersuchungshaft meidet sie die Krankenstation. Elke versucht, durchzuhalten. Angesichts der kräftezehrenden Arbeit und der furchtbaren Verpflegung – Suppen aus Gemüseabfällen und ranzigem Fleisch sowie Brot mit Margarine, Marmelade und Harzer Käse – magert sie nach wie vor ab.
Als eines Tages Maden in der Suppe schwimmen, reicht es den Frauen. Die politisch Verurteilten aus Elkes Zelle erproben den Aufstand. Anstatt sich im Speisesaal zu setzen, bleiben sie an den Bänken stehen und summen »Die Gedanken sind frei«. Für wenige Minuten fühlen sie sich stark und zuversichtlich und zeigen, dass sie noch über einen freien Willen verfügen. Doch der Protest wird hart bestraft: Man führt die Gefangenen in eine Kellerzelle, in der kniehoch das Wasser steht. Darin müssen sie stundenlang im Kreis laufen.
»Gefühlt verging eine Ewigkeit. Es wurde wieder neues Wasser zugeführt, so dass es sich nicht erwärmen konnte. Es war bitterkalt. Vor Kälte mussten wir urinieren und wateten in unserem eigenen Urin. Meine heutigen Träume sind so real, ich empfinde die Kälte, den stechenden Schmerz, die Müdigkeit, die Dunkelheit, den militärischen Drill.«
Nach zweieinhalb Monaten in Hoheneck erhält Elke Besuch von ihrer Mutter Besuch. Dieser ist es peinlich, überhaupt ins Gefängnis zu kommen, nun sitzt sie der Tochter mit deren vom Tee braunen Zähnen, dem dünnen Haar und der schmutzigen Anstaltskleidung gegenüber. Sie dürfen nur über Belanglosigkeiten reden. Plötzlich hört Elke ihren Sohn im Nachbarraum weinen. Ihre Mutter hat Tony mitgebracht, da sie hoffte, Elke dürfe ihn sehen. Doch das wird nicht erlaubt und das Wachpersonal macht sich sogar höhnisch lustig über die Situation. Elkes Herz verkrampft sich vor Schmerz.
Im September 1984 wird Elke überraschend freigekauft. Sie wiegt nur noch 37,5 Kilo. Elke wird zur MfS-Untersuchungshaftanstalt in Karl-Marx-Stadt transportiert, das sogenannte Kaßberg-Gefängnis. Fast 90 Prozent der Freigekauften werden von hier aus in die Bundesrepublik entlassen. Der Häftlingsfreikauf ist für die DDR ein lukratives Geschäft. Zwischen 1963 und 1989 werden in diesem Zusammenhang 33.755 Menschen aus den DDR-Gefängnissen geholt. Die Bundesrepublik bezahlt rund 95.000 D-Mark pro Person – insgesamt mehr als 3,5 Milliarden D-Mark.
»Da gings uns besser. Wir kriegten Bohnenkaffee, besseres Essen, durften jeden Tag duschen.«
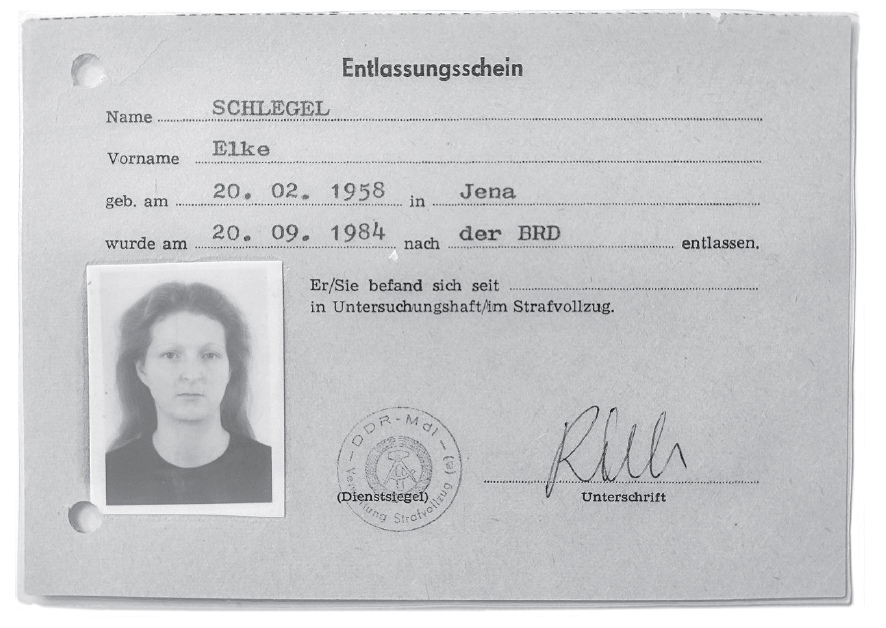
Das Foto auf Elkes Haftentlassungsschein vom September 1984 zeigt eindrücklich, wie sehr die Haft sie optisch verändert hat
Als Elke am 20. September 1984 die Reise in ihr neues Leben in der Bundesrepublik antritt, ist sie am Boden zerstört, denn Thomas sitzt nicht mit im Bus.
»Im Kaßberg pfiff ich immer »Moonlight Shadow« von Mike Oldfield. Das war unser Lied. Und ich kriegte Antwort. Ich dachte, das ist der Thomas. Ich war siegessicher, dass der im Bus sitzt.«
Elke will am liebsten direkt aussteigen, wird jedoch von jemandem festgehalten. Es ist ein ehemaliger Schulkamerad aus Jena, der gemeinsam mit Thomas in Cottbus inhaftiert war. Er versichert ihr, dass es Thomas gut gehe, dieser schon über ihren Freikauf Bescheid wisse und bald nachkomme.
»Jetzt war ich mutterseelenallein im Westen. Es war eigentlich der schönste Tag in meinem Leben. Ich wollte immer frei sein. Aber es war auch der traurigste Tag, denn ich war die Einzige, die niemanden zum Umarmen hatte, die nicht wusste, ob ihr Freund jemals kommt, die nicht wusste, ob sie ihr Kind jemals wiederkriegt.«
Im Notaufnahmelager wartet Elke einen Monat, dann wird endlich auch Thomas in die Bundesrepublik entlassen. Im Januar 1985 beziehen sie ihre erste eigene Wohnung in Koblenz, richten alles mit gefundenen und geschenkten Möbeln ein. Ihre oberste Priorität ist es, das Kinderzimmer herzurichten, weil dies die Bedingung dafür ist, Tony zu sich zu holen. Der Junge ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und hat fast ein ganzes Jahr bei seiner Großmutter gelebt, die ihm gestattete, sie »Mutti« zu nennen. Elkes Nerven sind zum Zerreißen gespannt, als sie am 10. Februar 1985 mit dem Zug in die DDR einreist.
»Ich hatte kein Visum. Ich durfte auch nur allein fahren. Ich hatte solche Angst, dass mir das Gleiche wieder passiert: dass sie mich dabehalten, dass sie uns wieder trennen oder irgendwas schiefgeht. Aber der Wille, unser Kind heimzuholen, war größer als die Angst.«
Als der Zug die innerdeutsche Grenze passiert und die Personenkontrollen erfolgen, wird Elke von bewaffneten Uniformierten abgeführt. In einem Zollhäuschen muss sie sich wie-der einmal detaillierten Durchsuchungen und langwierigen Befragungen unterziehen. Hunde bewachen sie wie eine Verbrecherin, während die Grenzbeamten telefonieren, um sich die Bestätigung einzuholen, dass eine Ausnahmegenehmigung zu Elkes Einreise- und Transitverbot vorliegt. Als sie endlich zum Zug zurückgebracht wird – vor den Augen aller Passagiere des wartenden Zugs und mit einem Gewehr im Nacken – zittert Elke am ganzen Körper. Unzählige Befürchtungen schießen ihr durch den Kopf, als sie den Bahnhof in Eisenach erreicht, wo die Übergabe stattfindet.
»Dort standen meine Oma, mein Bruder, meine Mutti und unser Sohn, und eine Pfütze war genau davor. Ich fiel mit den Knien hinein und umarmte ihn. Er wusste gar nicht, wer ich war und warum ich ihn so drückte. Wir hatten ein ganzes Jahr im Leben unseres Kindes verpasst.«
Elke und Thomas heiraten 1986. Die Wiedervereinigung betrachtet Elke nicht nur mit Freudentränen, sondern auch mit wachsender Sorge, nachdem ihr bewusst wird, dass nun auch für ihre Peiniger ganz Deutschland offensteht.
Nachdem ihr in Koblenz tatsächlich zufällig eine ehemalige Wärterin aus Hoheneck begegnet, bricht Elke zusammen. Sie quälen Albträume, heftige Migräneattacken und psychosomatische Beschwerden. Seit 2012 ist sie erwerbsunfähig. Die Suche nach Therapeuten, die ihre posttraumatische Belastungsstörung behandeln können, dauert Jahre. Viele Nachwirkungen der Haft teilt sie mit Thomas. Das Paar ist rastlos, zieht oft um, vermeidet geschlossene Türen.
Elke und Thomas erreichen ihre strafrechtliche Rehabilitierung und erhalten eine einmalige Kapitalentschädigung. Um die 2007 eingeführte Opferpension kämpft Elke jedoch jahrelang, denn der Anspruch darauf liegt damals bei 180 Hafttagen – Elke saß 177 Tage. Erst nach der Novellierung des Gesetzes erhält sie die sogenannte Opferrente.
Seit 2013 geht Elke als Zeitzeugin in Schulen, um jungen Menschen zu vermitteln, was es heißt, in einer Diktatur zu leben. Sie gibt Interviews für Gedenkstätten, Geschichtsprojekte und die Presse.
Elke engagiert sich in Opferverbänden und lässt 2018 am Deutschen Eck in Koblenz Informationstafeln errichten, die in fünf Sprachen über die einstigen Grenzanlagen, die Verfolgung und den Widerstand in der DDR informieren. 2020 erhält sie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Geschichte hält Elke in dem Buch »5 Monate und 24 Tage. Frauenzuchthaus Hoheneck – eine Extremerfahrung« fest.
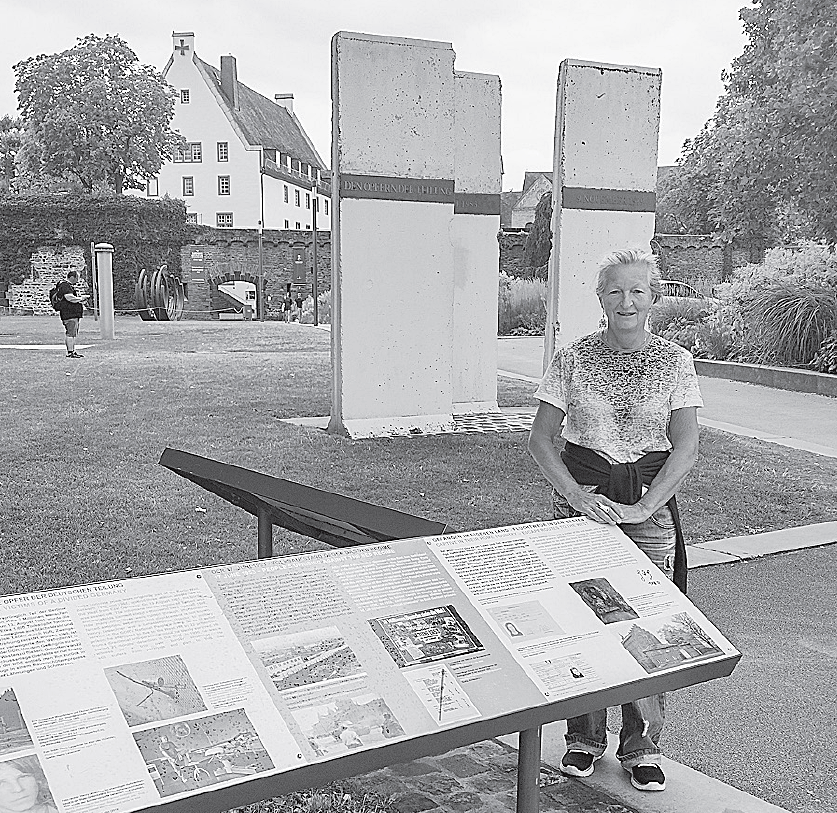
Elke vor den Informationstafeln am Deutschen Eck in Koblenz, Juli 2022
»Ich schrieb mir alles von der Seele. Eine Last fiel von mir, weil ich endlich mal alles aussprach.«
Thomas stirbt im Dezember 2021. Sein Verlust wiegt für Elke schwer, denn er war die Liebe ihres Lebens. Ihr Sohn ist mittlerweile verheiratet und hat selbst Kinder. Elke setzt sich heute für die Aufarbeitung des transgenerationalen Traumas ein. Dank ihrer Initiative wird nun vermehrt zur Übertragung traumatischer Erfahrungen innerhalb von Familien geforscht.

»Ich hoffe, dass ich es irgendwann vergessen kann.«
Elke Schlegel wird am 20. Februar 1958 in Jena geboren. Im Frühjahr 1961 zieht ein Teil der Verwandtschaft in den Westerwald. Elke und ihr Vater besuchen sie in der Bundesrepublik, wo ihr Vater am liebsten bleiben möchte. Doch Elkes Mutter ist zum zweiten Mal schwanger und will nicht umziehen, darum kehren Elke und ihr Vater zurück in die DDR. Als im Dezember 1961 Elkes Bruder zur Welt kommt, ist die innerdeutsche Grenze lückenlos abgeriegelt.
Elke übernimmt schon in jungen Jahren viel Verantwortung. In der Flaschenbierhandlung, die ihre Mutter als selbstständige Kommissionärin für die Handelsorganisation (HO) der DDR betreibt, muss Elke mithelfen.
Elke mag die Schwerpunkte der schulischen Erziehung nicht. Sie möchte Englisch lernen statt »Einführung in die sozialistische Produktion« oder Staatsbürgerkunde.
»Die Pioniernachmittage schwänzte ich oft. Dann wurde man Montagsmorgens in der Schule zum Fahnenappell vorgerufen und vor 600 Schülern öffentlich getadelt. Das war schon peinlich.«
Als ihre Mutter ihr die Christenlehre verbietet, geht sie heimlich. Die Konfirmation darf sie nicht mitmachen.
»Ich musste diese sozialistische Jugendweihe über mich ergehen lassen. Und da war dieser blöde Spruch: »Ab heute werden Sie in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen und die Welt steht Ihnen offen.« Da saß ich und dachte: Was für eine Lüge. Ich fing an, zu hinterfragen.«
Nach Abschluss der 10. Klasse möchte Elke Dekorateurin werden. Doch wegen der staatlichen Lenkung der Arbeitskräfte in der DDR bekommt sie eine Ausbildung im Interhotel in Jena. Die Hotelkette ist eine gehobene Klasse, in denen die DDR bevorzugt Gäste aus dem sozialistischen Ausland empfängt. Elke hat Freude am Kontakt mit den Gästen und kann ihr Englisch auffrischen. Mit einer Freundin fährt sie viel in den Urlaub.
»Ich war in der Tschechei, in Polen, in Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn. Und da war Schluss. Da war die Welt für uns zu Ende.«
1976 schließt sie ihre Lehre mit guten Noten ab. Elke bewirbt sich als Schiffsstewardess und Flugbegleiterin. Aufgrund ihrer Westverwandtschaft werden die Bewerbungen abgelehnt. Die 18-Jährige arbeitet weiterhin im Interhotel, wo ihr täglich Klassenunterschiede vor Augen geführt werden.
»Hier gab es Rinderfilet, Châteaux Briand, Edelgemüse. Es gab Blumenkohl, grüne Bohnen und Blattsalat. Es war alles da, was die normale Bevölkerung nicht kriegte.«
Mit 21 lernt Elke Thomas kennen. Schnell wird aus den beiden Verliebten ein unzertrennliches Paar. Weil sie nicht aufgeklärt wurde, merkt Elke erst spät, dass sie schwanger ist. Der Gynäkologe bietet ihr eine Abtreibung an, obwohl sie längst über den dritten Monat hinaus ist. Elke weiht nun Thomas ein, der sich überglücklich zeigt. Am 23. Juni 1981 entbindet Elke ihren gemeinsamen Sohn Tony in der Frauenklinik Jena. Ein hochemotionales Ereignis, das sie völlig allein bewältigen muss. Thomas darf sein Kind erst am Abend besuchen. Ihre Mütter kommen nicht.
Bei der Namensgebung erwartet sie eine unangenehme Überraschung. Sie dürfen den Namen ihres Sohnes nicht in der Schreibweise mit »y« in die Geburtsurkunde eintragen lassen, denn diesen Buchstaben gibt es im Sprachschatz der DDR angeblich nicht.
Die ersten Wochen zu Hause sind enorm anstrengend und belastend für die kleine Familie, die beengt in Elkes Kinderzimmer wohnt und darüber hinaus jeden Tag mit der Missbilligung von Elkes Mutter konfrontiert ist. Doch all ihre Bemühungen, auszuziehen, scheitern. Als unverheiratetes Paar haben Elke und Thomas keine Chance bei der staatlichen Wohnungsvergabe.
Kurzerhand richten sie sich in einem stillgelegten Altstoffhandel eine Wohnung her. Doch nach drei Monaten werden sie der Wohnraumbesetzung angeklagt und verlieren den Prozess. Neben der nun täglich drohenden Zwangsräumung sorgt sich Elke auch um die Zukunft ihres Sohnes.
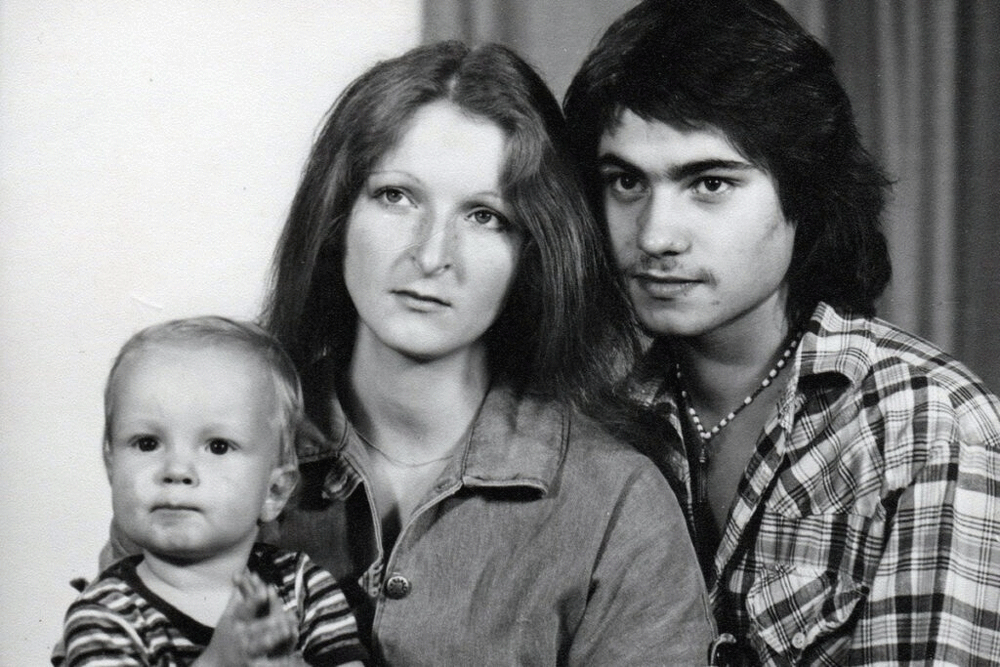
Elke, Thomas und ihr Sohn, 1982
»Als Junge wird er zur NVA gezogen. Dort gibt es einen Schießbefehl. Vielleicht muss er an die Grenze und irgendwelche Menschen umbringen. Dann wird er zum Mörder. Wir können den nicht beschützen. Wir wollten für unseren Sohn eine bessere Zukunft.«
Mit ihrer Einstellung fühlen sie sich zur Jungen Gemeinde der evangelischen Kirche hingezogen und treffen sich regelmäßig in getarnten Partykellern mit Gleichgesinnten. Doch die alltäglichen Konfrontationen, Repressionen und Verbote erschöpfen Elke und Thomas. Sie passen nicht ins typische Bild der DDR und leben in wilder Ehe. Westjeans und Parka sind ungern gesehen, westliche Musik verboten, Bücher bestimmter Autoren verbannt.
Im Interhotel will man die Belegschaft verpflichtend in der DDR-Massenorganisation Deutsch-Sowjetische Freundschaft  DSF unterbringen. Elke lehnt die Mitgliedschaft genauso ab wie das Wählen, das in der Praxis eben nicht frei und geheim stattfindet. In der Konsequenz gibt es für sie auf der Arbeitsstelle niemals Prämien oder Auszeichnungen. Elke lernt, klar zwischen ihrer öffentlichen und der privaten Meinung zu unterscheiden. Sie fühlt sich der elementarsten Menschenrechte beraubt.
DSF unterbringen. Elke lehnt die Mitgliedschaft genauso ab wie das Wählen, das in der Praxis eben nicht frei und geheim stattfindet. In der Konsequenz gibt es für sie auf der Arbeitsstelle niemals Prämien oder Auszeichnungen. Elke lernt, klar zwischen ihrer öffentlichen und der privaten Meinung zu unterscheiden. Sie fühlt sich der elementarsten Menschenrechte beraubt.
»Es war die Reisefreiheit eingeschränkt, die Meinungsfreiheit, meine Religionsfreiheit. Meine Berufswahl war mir verwehrt worden. Wir bekamen nicht mal eine Wohnung. In jeder Gaststätte musste man verdammt aufpassen, was man erzählte. Für so einen blöden politischen Honecker-Witz wurde man ja verhaftet. Wir hatten die ganzen Schikanen satt. Wir saßen auf einer Bombe, die jeden Tag explodieren konnte.«
Elke und Thomas wollen die DDR verlassen. Als Elkes westdeutscher Cousin sie im Sommer 1983 besucht, fragen sie ihn aus. Sie wollen ihre Chancen auf Arbeit und eine gemeinsame Wohnung abklären und wissen, wie es mit der Schulbildung oder der Reise- und Religionsfreiheit im Westen aussieht. Für das Paar steht schnell fest, dass es auf keinen Fall illegal fliehen möchte, um sich und das Kind zu schützen.
Im September 1983 stellen sie einen Ausreiseantrag und werden damit Teil einer Bewegung, die wesentlich zum Zusammenbruch der SED-Diktatur beiträgt. Insgesamt über 400.000 Antragsteller dürfen in die Bundesrepublik übersiedeln.
Gesetzlich ist eine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR nicht vorgesehen. Elke und Thomas berufen sich auf das Recht auf Freizügigkeit, das Erich Honecker 1975 mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki den DDR-Bürgern zusichert. Antragsteller zahlen oft den hohen Preis von langwierigen Repressionen auf persönlicher, familiärer und beruflicher Ebene.
Das erfahren auch Elke und Thomas. Beide werden auf der Arbeitsstelle degradiert. Deut-lich schlimmer wiegen die Schikanen des Kindergartens. Sie wird von Thomas‘ Tante aus Westberlin mit Wegwerfwindeln unterstützt. Doch die Erzieher weigern sich, das Produkt aus dem »kapitalistischen Ausland« zu verwenden und lassen Tony so lange in feuchten Windeln liegen, bis er furchtbar wund ist.
Elke sieht keine andere Möglichkeit, als sich in den Spätdienst versetzen zu lassen. Ab sofort betreut sie ihren Sohn tagsüber, Thomas übernimmt dann nach seinem Arbeitsschluss. Weil in ihnen die Sorge wächst, einmal getrennt zu werden, will das Paar heiraten. Doch nach der Vorlage ihres PM 12 erhalten sie nicht einmal einen Termin auf dem Standesamt.
In der Absicht, ihre Verwandten vor der Sippenhaft zu schützen, möchte Elke sich von ihnen lossagen. Die Familie reagiert sehr unterschiedlich auf den Ausreiseantrag. Während ihre Mutter so wütend ist, dass sie Elke ohrfeigt und ihr vorwirft, sie mache ihr das Geschäft kaputt, möchte ihr Vater mitkommen und bittet sie, ihm ebenfalls einen Antrag zu formulieren. Auch Elkes Bruder möchte mit ausreisen. Seine schwangere Freundin will allerdings die Geburt des Kindes abwarten. Kurz darauf wird ihr Bruder zur Nationalen Volksarmee  NVA gezogen und bei der Bereitschaftspolizei in Rudolstadt eingesetzt.
NVA gezogen und bei der Bereitschaftspolizei in Rudolstadt eingesetzt.
Obwohl ab Anfang der 1980er-Jahre Zehntausende DDR-Bürger Ausreiseanträge stellen, kommt es nur selten vor, dass sich Antragsteller untereinander solidarisieren oder gar organisieren. Viele verhalten sich lieber so unauffällig wie möglich. Eine Ausnahme ist jedoch der Jenaer Weiße Kreis. Eine Protestgruppe, die ihre Anträge auf Ausreise öffentlich machen will. Als stilles und doch für jedermann sichtbares Erkennungszeichen stellen Elke und Thomas eine weiße Friedenstaube ins Fenster und tragen ein weißes Armband am Handgelenk.
An jedem Dienstag, dem offiziellen Sprechtag, suchen sie den Rat der Stadt Jena auf und fragen nach, wie es mit der Bearbeitung ihres Ausreiseersuchens aussehe. Wiederholt wird der Antrag abgelehnt. Eine Begründung hierfür erhalten sie nie. Unbeirrt stellen sie jedes Mal einen neuen Antrag.
Und sie nehmen an den stummen Demonstrationen des Weißen Kreises teil. Dieser trifft sich ab dem Sommer 1983 regelmäßig am Samstagmorgen auf dem Platz der Kosmonauten in Jena. Die Anzahl der Personen, die sich an den Händen fassen und schweigend einen Kreis bilden, wächst beständig. Beim Ministerium für Staatssicherheit  MfS gilt der Weiße Kreis als »feindlich-negative Gruppierung rechtswidrig um Übersiedlung ersuchender Personen im Bezirk Gera«. Die Teilnehmer des Weißen Kreises werden von der Stasi durch ständige Überwachung und Verhöre unter Druck gesetzt, ein Großteil sogar verhaftet.
MfS gilt der Weiße Kreis als »feindlich-negative Gruppierung rechtswidrig um Übersiedlung ersuchender Personen im Bezirk Gera«. Die Teilnehmer des Weißen Kreises werden von der Stasi durch ständige Überwachung und Verhöre unter Druck gesetzt, ein Großteil sogar verhaftet.
Auch Elke und Thomas werden wiederholt von der Arbeit, aus der Wohnung oder direkt von der Straße weggeholt und über mehrere Stunden hinweg verhört.
»Demonstrieren war verboten. Wir standen einfach schweigend da und fassten uns an den Händen. Aber das erregte in Jena schon Aufsehen. Und dann wurde versucht, das zu unterbinden.«
Auch am 10. Dezember 1983, dem Tag der Menschenrechte, trifft sich die Gemeinschaft der Antragsteller. Mit einer brennenden weißen Kerze in der Hand stellen sie sich auf den Weihnachtsmarkt. Eine subtile Botschaft, mit der sie sich sicher fühlen. Doch die DDR-Behörden sehen das anders und schicken die Bereitschaftspolizei, um die Gruppe schnell und effektiv verhaften zu lassen.
»Das war mit das Schlimmste, was mir passierte: Mein Bruder stand uns gegenüber und musste uns verhaften. Das Gefühl, dass dein eigen Fleisch und Blut mit einem geladenen Maschinengewehr vor dir steht, kann man überhaupt nicht beschreiben.«
Um die »Störenfriede« loszuwerden, genehmigen die DDR-Behörden in Jena innerhalb weniger Monate eine hohe Anzahl von Ausreiseanträgen. Im März 1984 bedeutet man Elke und Thomas, die Bewilligung ihrer Anträge stünde unmittelbar bevor. Zu diesem Zeitpunkt haben sie ihr Ausreiseanliegen achtmal wiederholt. Hoffnungsvoll treffen sie alle Vorbereitungen.
Doch stattdessen werden sie am 28. März 1984 verhaftet. In den frühen Morgenstunden hämmert es vehement gegen ihre Wohnungstür. Im nächsten Moment ist das Schloss zertrümmert, fünf Männer in Zivil und eine uniformierte Frau stürmen die Wohnung. Elke und Thomas werden aufgefordert, sich anzuziehen und – wieder einmal – zur »Klärung eines Sachverhalts« mitzukommen.
Doch etwas ist anders, das spürt Elke genau. Nicht nur, dass dies ein außergewöhnlich hohes Aufgebot an Beamten ist. Weil Thomas zuerst abgeführt wird, kann Elke durchs Fenster sehen, dass das Auto nicht wie üblich stadteinwärts, sondern in Richtung Autobahn abfährt. Ihr mulmiges Gefühl wächst.
Sie zieht den zweieinhalbjährigen Tony an und will ihn in die Krippe bringen, doch die Beamtin verbietet dies. Stattdessen fährt man sie zu ihrer Mutter und klingelt diese wach, um den Sohn ihn ihre Obhut zu geben. Die Beamtin rückt Elke nicht von der Seite und ermöglicht nur wenige, hastige Sätze des Abschieds im Treppenhaus. Diese Bilder werden Elke Zeit ihres Lebens verfolgen.
»Ich sagte: »Mutti, kannst du bitte auf unser Kind aufpassen. Ich glaube, wir sehen uns nicht wieder.« Der Junge saß unten auf der Treppe, ich kniete mich zu ihm hin und sagte: »Ich geh dir was Schönes kaufen. Ich bin bald wieder da.« Das war der Abschied. Ich wollte ihn eigentlich noch umarmen und drücken, da zog die mich weg.«
Elke versucht mit größter Anstrengung, ihre Tränen zu unterdrücken, um der MfS-Beamtin keinen Triumph zu gönnen. Überwältigt von der Befürchtung, ihren Sohn nie wieder zu sehen, lässt Elke sich nach Gera abtransportieren.
In der dortigen Untersuchungshaftanstalt (UHA) der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit (BVfS) setzt man sie in ein fensterloses Verhörzimmer und vernimmt sie stundenlang. Zuerst wirft man ihr Republikflucht vor.
»Ich verstand es einfach nicht. Ich dachte, das wäre ein riesengroßer Irrtum. Wir haben nichts verbrochen. Die können uns nicht festhalten.«
Der MfS-Beamte brüllt, dann spricht er wieder in ruhigem Ton. Elke muss an der Wand stehen, dann wieder auf dem Hocker sitzen, die Hände unter den Oberschenkeln. Sie friert, hat Hunger und Durst und muss auf die Toilette. Der Stress bereitet ihr Kopfschmerzen, sie verliert das Zeitgefühl und die Konzentration. Immer wieder denkt sie an ihren Sohn. Dann ergreift sie die Panik und das Herz schlägt bis zum Hals. Der Vernehmer nutzt ihren Zustand aus und bearbeitet sie intensiver.
»Ich wollte nicht weinen, weil ich zu stolz war, denen zu zeigen, dass mir das alles wehtut, was die mit mir machen. Du lässt dich nicht kleinkriegen.«
Irgendwann am Abend ist das Verhör vorbei. Elke wird in einen anderen Bereich der Untersuchungshaftanstalt abgeführt, wo man sie als Häftling registriert und ihr dazu zunächst die Fingerabdrücke abnimmt. Um Fotos anzufertigen, setzt man sie auf einen Stuhl und schnallt ihre Arme daran fest. Dann richtet man ein grelles Licht auf sie und lässt sie allein. Hinter Elke hängt ein dicker schwarzer Vorhang. In Panik erinnert sie sich an den Schulausflug nach Buchenwald, wo man ihnen eine Genickschussanlage der Nazis zeigte, die hinter einem ähnlichen Vorhang versteckt war.
Kurz darauf wird Elke an eine barsche Wachhabende übergeben, vor der sie sich nackt ausziehen und an die sie ihre Kleidung, den Verlobungsring sowie das Foto ihres Sohnes abgeben muss. Dann erfolgt eine körperliche Untersuchung, die erniedrigender kaum sein könnte.
»Sie guckte in alle Löcher, die eine Frau hat. Das war so menschenunwürdig, so deprimierend. Ich wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher und hatte nichts gemacht. Dann musste ich splitterfasernackt über den Gang laufen, an männlichen Wachposten vorbei. Ich schämte mich so.«
Elke wird in eine Zelle gesperrt. Drei Monate gibt es nichts anderes als die Vernehmungen und das Sitzen und Warten. Der ständige Schlafman¬gel sowie Stress und Angst setzen ihr zu. Elke hat keinen Appetit und Bauchschmerzen. Die 26-Jährige magert ab.
»Für mich war das Schlimmste, dass sie mir mein Kind weggenommen hatten. Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht einfacher durch die ganze Sache gekommen, dann hätte ich nur auf mich aufpassen müssen.«
Immer wieder bittet Elke um Auskunft, wie es ihrem Sohn ergehe. Sie weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als in den Hungerstreik zu gehen. Doch man droht ihr eine Zwangsernährung an. Also fügt sie sich und isst wieder.
Nach den Vernehmungen fühlt sich Elke jedes Mal mehr gedemütigt, ausgelaugt und völlig erschöpft. Die MfS-Beamten drohen ihr, dass sie ihr Kind und Thomas niemals wieder sehen werde. Elke ist wütend, dass die Staatssicherheit über so viel Macht verfügt, sie für Verbrechen einzusperren, die sie gar nicht begangen hat.
Im Juni 1984 wird Elke wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme zu ihrem westdeutschen Cousin zu einem Jahr und sechs Monaten Strafvollzug verurteilt. Thomas erhält einen Monat weniger.
Wenige Tage später wird Elke ins sächsische Stollberg gebracht. Hoheneck, eine ehemalige Ritterburg, ist die zentrale Frauenhaftanstalt der DDR. In dem alten Gemäuer sperrt man bei beißender Kälte, mangelhafter Ernährung und harter Arbeit politisch Verurteilte mit kriminellen Schwerverbrecherinnen zusammen, um sie gezielt einzuschüchtern.
Elke wird einer Großzelle mit 42 Frauen zugeteilt. Es gibt eine strenge Ordnung fürs Bettenmachen, einen morgendlichen Zählappell. In der Zelle herrscht eine strenge Hierarchie und die sogenannte Verwahrraumälteste hat für die nötige Disziplin zu sorgen. Das Wach¬perso¬nal duldet Übergriffe mit kalter Gleichgültigkeit und führt selbst härteste Bestrafungen durch.
Elke lernt schnell, sich so unauffällig wie möglich zu benehmen. Um sexuellen Übergriffen zu entgehen, täuscht sie eine lesbische Beziehung mit einer Mitgefangenen vor. Dennoch bleibt die ständige Angst.
Privatsphäre existiert nicht. Ein großer Trog mit fünf Wasserhähnen, die nur eiskaltes Wasser führen, sowie zwei Toiletten müssen für alle 42 Insassinnen reichen. Zählappelle, Zellenrazzien und demütigende körperliche Untersuchungen gehören genauso zum Gefängnisalltag wie die Haftarbeit: Im Dreischichtsystem mit acht Stunden an sechs Tagen der Woche muss Elke Strumpfhosen-Rohlinge über ein 60 Grad heißes Eisen ziehen. Die Norm liegt bei 1.200 pro Tag. Das schafft Elke kein einziges Mal.
Von der gesundheitsschädlichen Arbeit bekommt sie Atemprobleme und Warzen an den Händen. Doch nach einem entsetzlichen Zahnarztbesuch während der Untersuchungshaft meidet sie die Krankenstation. Elke versucht, durchzuhalten. Angesichts der kräftezehrenden Arbeit und der furchtbaren Verpflegung – Suppen aus Gemüseabfällen und ranzigem Fleisch sowie Brot mit Margarine, Marmelade und Harzer Käse – magert sie nach wie vor ab.
Als eines Tages Maden in der Suppe schwimmen, reicht es den Frauen. Die politisch Verurteilten aus Elkes Zelle erproben den Aufstand. Anstatt sich im Speisesaal zu setzen, bleiben sie an den Bänken stehen und summen »Die Gedanken sind frei«. Für wenige Minuten fühlen sie sich stark und zuversichtlich und zeigen, dass sie noch über einen freien Willen verfügen. Doch der Protest wird hart bestraft: Man führt die Gefangenen in eine Kellerzelle, in der kniehoch das Wasser steht. Darin müssen sie stundenlang im Kreis laufen.
»Gefühlt verging eine Ewigkeit. Es wurde wieder neues Wasser zugeführt, so dass es sich nicht erwärmen konnte. Es war bitterkalt. Vor Kälte mussten wir urinieren und wateten in unserem eigenen Urin. Meine heutigen Träume sind so real, ich empfinde die Kälte, den stechenden Schmerz, die Müdigkeit, die Dunkelheit, den militärischen Drill.«
Nach zweieinhalb Monaten in Hoheneck erhält Elke Besuch von ihrer Mutter Besuch. Dieser ist es peinlich, überhaupt ins Gefängnis zu kommen, nun sitzt sie der Tochter mit deren vom Tee braunen Zähnen, dem dünnen Haar und der schmutzigen Anstaltskleidung gegenüber. Sie dürfen nur über Belanglosigkeiten reden. Plötzlich hört Elke ihren Sohn im Nachbarraum weinen. Ihre Mutter hat Tony mitgebracht, da sie hoffte, Elke dürfe ihn sehen. Doch das wird nicht erlaubt und das Wachpersonal macht sich sogar höhnisch lustig über die Situation. Elkes Herz verkrampft sich vor Schmerz.
Im September 1984 wird Elke überraschend freigekauft. Sie wiegt nur noch 37,5 Kilo. Elke wird zur MfS-Untersuchungshaftanstalt in Karl-Marx-Stadt transportiert, das sogenannte Kaßberg-Gefängnis. Fast 90 Prozent der Freigekauften werden von hier aus in die Bundesrepublik entlassen. Der Häftlingsfreikauf ist für die DDR ein lukratives Geschäft. Zwischen 1963 und 1989 werden in diesem Zusammenhang 33.755 Menschen aus den DDR-Gefängnissen geholt. Die Bundesrepublik bezahlt rund 95.000 D-Mark pro Person – insgesamt mehr als 3,5 Milliarden D-Mark.
»Da gings uns besser. Wir kriegten Bohnenkaffee, besseres Essen, durften jeden Tag duschen.«
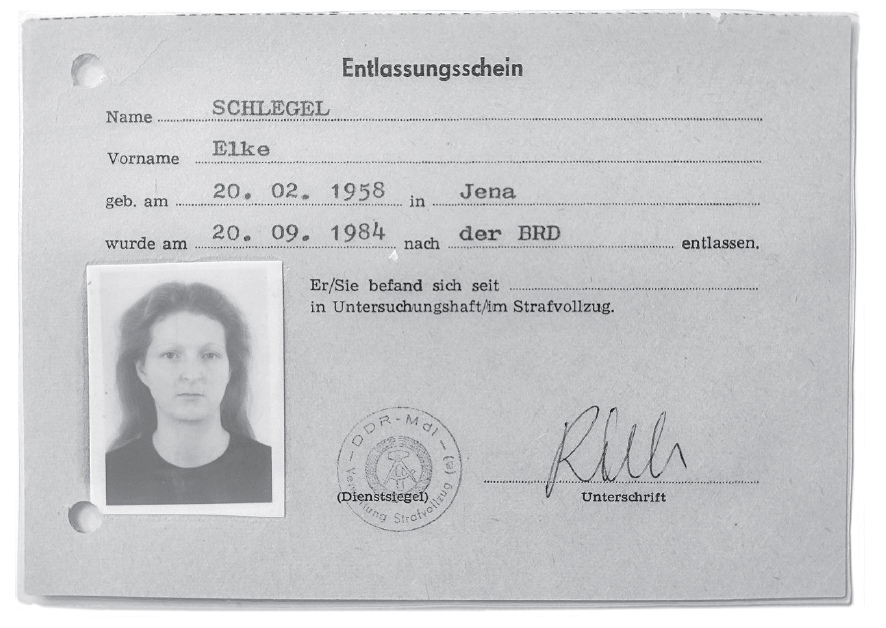
Das Foto auf Elkes Haftentlassungsschein vom September 1984 zeigt eindrücklich, wie sehr die Haft sie optisch verändert hat
Als Elke am 20. September 1984 die Reise in ihr neues Leben in der Bundesrepublik antritt, ist sie am Boden zerstört, denn Thomas sitzt nicht mit im Bus.
»Im Kaßberg pfiff ich immer »Moonlight Shadow« von Mike Oldfield. Das war unser Lied. Und ich kriegte Antwort. Ich dachte, das ist der Thomas. Ich war siegessicher, dass der im Bus sitzt.«
Elke will am liebsten direkt aussteigen, wird jedoch von jemandem festgehalten. Es ist ein ehemaliger Schulkamerad aus Jena, der gemeinsam mit Thomas in Cottbus inhaftiert war. Er versichert ihr, dass es Thomas gut gehe, dieser schon über ihren Freikauf Bescheid wisse und bald nachkomme.
»Jetzt war ich mutterseelenallein im Westen. Es war eigentlich der schönste Tag in meinem Leben. Ich wollte immer frei sein. Aber es war auch der traurigste Tag, denn ich war die Einzige, die niemanden zum Umarmen hatte, die nicht wusste, ob ihr Freund jemals kommt, die nicht wusste, ob sie ihr Kind jemals wiederkriegt.«
Im Notaufnahmelager wartet Elke einen Monat, dann wird endlich auch Thomas in die Bundesrepublik entlassen. Im Januar 1985 beziehen sie ihre erste eigene Wohnung in Koblenz, richten alles mit gefundenen und geschenkten Möbeln ein. Ihre oberste Priorität ist es, das Kinderzimmer herzurichten, weil dies die Bedingung dafür ist, Tony zu sich zu holen. Der Junge ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und hat fast ein ganzes Jahr bei seiner Großmutter gelebt, die ihm gestattete, sie »Mutti« zu nennen. Elkes Nerven sind zum Zerreißen gespannt, als sie am 10. Februar 1985 mit dem Zug in die DDR einreist.
»Ich hatte kein Visum. Ich durfte auch nur allein fahren. Ich hatte solche Angst, dass mir das Gleiche wieder passiert: dass sie mich dabehalten, dass sie uns wieder trennen oder irgendwas schiefgeht. Aber der Wille, unser Kind heimzuholen, war größer als die Angst.«
Als der Zug die innerdeutsche Grenze passiert und die Personenkontrollen erfolgen, wird Elke von bewaffneten Uniformierten abgeführt. In einem Zollhäuschen muss sie sich wie-der einmal detaillierten Durchsuchungen und langwierigen Befragungen unterziehen. Hunde bewachen sie wie eine Verbrecherin, während die Grenzbeamten telefonieren, um sich die Bestätigung einzuholen, dass eine Ausnahmegenehmigung zu Elkes Einreise- und Transitverbot vorliegt. Als sie endlich zum Zug zurückgebracht wird – vor den Augen aller Passagiere des wartenden Zugs und mit einem Gewehr im Nacken – zittert Elke am ganzen Körper. Unzählige Befürchtungen schießen ihr durch den Kopf, als sie den Bahnhof in Eisenach erreicht, wo die Übergabe stattfindet.
»Dort standen meine Oma, mein Bruder, meine Mutti und unser Sohn, und eine Pfütze war genau davor. Ich fiel mit den Knien hinein und umarmte ihn. Er wusste gar nicht, wer ich war und warum ich ihn so drückte. Wir hatten ein ganzes Jahr im Leben unseres Kindes verpasst.«
Elke und Thomas heiraten 1986. Die Wiedervereinigung betrachtet Elke nicht nur mit Freudentränen, sondern auch mit wachsender Sorge, nachdem ihr bewusst wird, dass nun auch für ihre Peiniger ganz Deutschland offensteht.
Nachdem ihr in Koblenz tatsächlich zufällig eine ehemalige Wärterin aus Hoheneck begegnet, bricht Elke zusammen. Sie quälen Albträume, heftige Migräneattacken und psychosomatische Beschwerden. Seit 2012 ist sie erwerbsunfähig. Die Suche nach Therapeuten, die ihre posttraumatische Belastungsstörung behandeln können, dauert Jahre. Viele Nachwirkungen der Haft teilt sie mit Thomas. Das Paar ist rastlos, zieht oft um, vermeidet geschlossene Türen.
Elke und Thomas erreichen ihre strafrechtliche Rehabilitierung und erhalten eine einmalige Kapitalentschädigung. Um die 2007 eingeführte Opferpension kämpft Elke jedoch jahrelang, denn der Anspruch darauf liegt damals bei 180 Hafttagen – Elke saß 177 Tage. Erst nach der Novellierung des Gesetzes erhält sie die sogenannte Opferrente.
Seit 2013 geht Elke als Zeitzeugin in Schulen, um jungen Menschen zu vermitteln, was es heißt, in einer Diktatur zu leben. Sie gibt Interviews für Gedenkstätten, Geschichtsprojekte und die Presse.
Elke engagiert sich in Opferverbänden und lässt 2018 am Deutschen Eck in Koblenz Informationstafeln errichten, die in fünf Sprachen über die einstigen Grenzanlagen, die Verfolgung und den Widerstand in der DDR informieren. 2020 erhält sie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Geschichte hält Elke in dem Buch »5 Monate und 24 Tage. Frauenzuchthaus Hoheneck – eine Extremerfahrung« fest.
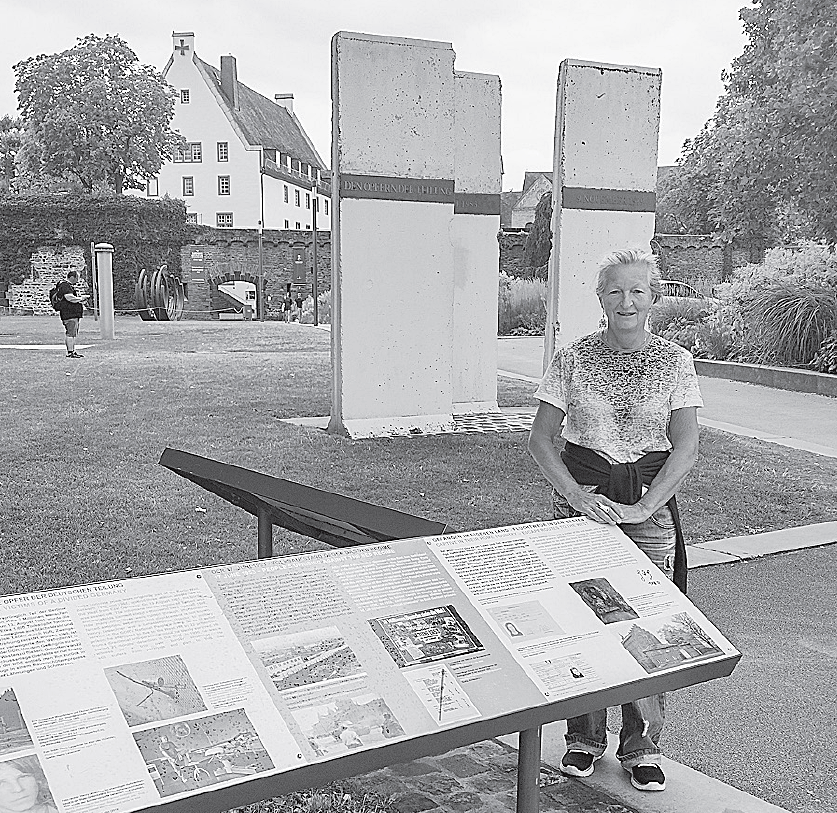
Elke vor den Informationstafeln am Deutschen Eck in Koblenz, Juli 2022
»Ich schrieb mir alles von der Seele. Eine Last fiel von mir, weil ich endlich mal alles aussprach.«
Thomas stirbt im Dezember 2021. Sein Verlust wiegt für Elke schwer, denn er war die Liebe ihres Lebens. Ihr Sohn ist mittlerweile verheiratet und hat selbst Kinder. Elke setzt sich heute für die Aufarbeitung des transgenerationalen Traumas ein. Dank ihrer Initiative wird nun vermehrt zur Übertragung traumatischer Erfahrungen innerhalb von Familien geforscht.