
»Ich hätte das ganze Spiel so lange mitgemacht, bis ich aus der DDR rausgekommen wäre.«
Kerstin Meisner wird am 13. Januar 1964 in Potsdam-Babelsberg geboren und wächst bei Dessau auf. 1973 zieht sie mit ihrer Mutter wieder zurück nach Potsdam, dort heiratet ihre Mutter ein zweites Mal. Kerstin ist eine fleißige Schülerin, sportlich aktiv und hat einen guten Freundeskreis, der ihr Ablenkung und vor allem den Halt gibt, den sie in ihrer Familie nicht bekommt. Ihre Mutter sowie ihr Großvater sind depressiv, tabletten- und alkoholabhängig.
»Ich fing innerlich langsam an, mich von meiner Mutter zu lösen, weil ich mit dieser Situation nicht klarkam.«
Beim Erwachsenwerden setzt sich Kerstin auch mehr und mehr mit ihrem Umfeld auseinander. In Potsdam ist es möglich, Fernsehprogramme aus der Bundesrepublik Deutschland zu empfangen. Sie schaut im Westfernsehen Sendungen wie »Monitor« oder »Report München« und schärft ihren Blick für den deutlichen Unterschied zwischen der ostdeutschen Propaganda und ihrer Lebensrealität, die unter der Mangelwirtschaft und der Diktatur leidet.
»Ich wunderte mich immer: »Die Planerfüllung liegt bei 100 Prozent, und wieder 150 Prozent, und alles ist toll.« Aber es war weiß Gott nicht alles super. Die Häuser verfielen, die Straßen verfielen. Wenn Brot mittags alle war, war das Brot halt alle, Punkt.«
Angesichts der offensichtlichen Unstimmigkeiten macht sich ein wachsendes Unwohlsein in Kerstin breit. Sie stellt ihre unbequemen Fragen im Staatsbürgerkundeunterricht. In der Folge fallen ihre Zeugnisse schlechter aus – nicht im Bereich der fachlichen Leistungen, doch bei den sogenannten Kopfnoten Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung, die im Schulsystem der DDR das Arbeits- und Sozialverhalten der Kinder bewerten sollen.
»Ich wollte auch nicht zu den Pionieren, das lehnte ich alles ab. Ab dem Jugendalter fand ich diese Ideologie einfach nur noch falsch. Ich fand nur den Zusammenhalt gut, und dass wir viel in der Freizeit machten.«
Kerstin darf nach der zehnten Klasse nicht auf die Erweiterte Oberschule (EOS) wechseln, um die Hochschulreife zu erlangen. Das Abitur wird in der DDR nur zehn Prozent eines Jahrgangs gewährt, in der Regel Schülerinnen und Schüler mit einem sehr guten Notendurchschnitt sowie einer politischen Einstellung und sozialen Herkunft, die im Sinne des Staates sind. Auf Rat ihres Vaters macht Kerstin eine Berufsausbildung – nicht in ihrem Wunschberuf, doch sie hat nicht viele Möglichkeiten.
»Ich wollte Drucker und Setzerin werden, wurde aber abgelehnt wegen meiner schlechten Noten. Dann wollte ich Kfz-Mechanikerin werden, dafür war ich zu klein. Für Tankwart war ich auch zu klein, und eine Frau, und zu schwach. Aber ich wollte nicht ins Büro. Zum Schluss landete ich dann in einer Brauerei als Facharbeiter für Anlagentechnik.«
Am Beginn der Berufsausbildung lernt Kerstin Thomas kennen und lieben. Das Paar eint unter anderem, dass sich beide gleichermaßen im System nicht aufgehoben und im Elternhaus unverstanden fühlen. Während Kerstin unter dem Alkoholismus ihrer Mutter leidet, lehnt Thomas die politische Meinung seiner Eltern, die überzeugte SED-Parteimitglieder sind, ab.
Mit einem Freund, Carsten, teilen Kerstin und Thomas politische Ideale und sehnen sich nach Meinungsfreiheit, Demokratie und weniger Reglementierungen. Die Reisefreiheit ist den Jugendlichen nicht so wichtig, doch Demokratie und Umweltpolitik ein großes Thema – und gleichzeitig eins, das in der DDR totgeschwiegen wird. Kerstin hat in Dessau oft gesehen, wie die Mulde durch die eingeleiteten Giftstoffe des Chemiekombinats Bitterfeld Schaumkronen trägt. Sie wünscht sich Veränderung und einen offenen Diskurs. Die Umweltpolitik und vor allem die progressive und unkonventionelle Art der Grünen Partei in der Bundesrepublik inspirieren Kerstin.
In ihrem Umfeld spürt Kerstin eine Zeit des Aufbruchs, des Aufbegehrens. Die Jugendlichen wollen nicht das System ändern – sie wissen auch gar nicht, wie. Aber sie lehnen ihr Leben in der DDR und ihre Familien ab und wollen ein neues Leben beginnen.
»Dann wurde der Gedanke geboren, in den Westteil des Landes zu gehen.«
Ab dem Spätsommer 1982 verfolgen die Freunde verschiedene Ideen, wie sie die DDR verlassen könnten. Sie schauen sich die Grenzanlagen an.
»Tod durch Erschießen war nicht unser Ziel. Also hat sich relativ schnell rauskristallisiert, es wird weder Berlin noch die westdeutsche Grenze, weil das viel zu sehr gesichert ist. Wir wussten von den Selbstschussanlagen, von den Minen, von dem ewig breiten Streifen, auf dem man sogar jede Spur eines Vogels sah, und dass es Hunde, dass es Patrouillen gab.«
Die Freunde ziehen auch nicht in Betracht, einen Antrag auf ständige Ausreise aus der DDR zu stellen. Dieses Ersuchen ermöglicht zwar über 400.000 Personen ein neues Leben in der Bundesrepublik. Gesetzlich ist eine Ausreise aus der DDR aber nicht vorgesehen und gilt als inakzeptable Absage an den Staat. Antragsteller müssen oft langwierige und harte Schikanen auf persönlicher, familiärer und beruflicher Ebene ertragen.

Kerstin zu Anfang der 1980er Jahre
Die 19-jährige Kerstin will eine schnelle Lösung. Sie möchte einen Fluchtversuch, der ungefährlich ist – der allerdings nicht erfolgreich sein muss. Die Freunde nehmen billigend in Kauf, den Weg über die Verhaftung und den Häftlingsfreikauf zu gehen. Dass die Bundesrepublik politische Häftlinge freikauft, ist ihnen bekannt.
»Die DDR war ja chronisch pleite. Man kann es modernen Menschenhandel nennen, war uns relativ egal.«
Der geplante Fluchtversuch soll über die damalige Tschechoslowakische Sozialistische Republik (ČSSR) erfolgen. Bei Bratislava wollen die Freunde nach Österreich und von hier aus wiederum nach Bayern fahren. Kerstin plant, sich im Zug auf dem Klo zu verstecken, weil sie ihren Ausweis verloren hat.
»Uns war klar, dass unser Fluchtversuch zu 80 Prozent nicht funktionieren wird. Dass wir ins Gefängnis gehen werden, dass sie uns erwischen werden. Deswegen haben wir uns gar nicht so viele Gedanken gemacht.«
Am 12. April 1983 besteigen Carsten, Thomas und Kerstin in Berlin-Schönefeld einen Fernzug in Richtung Bratislava. Kerstin hat nicht mehr dabei als ihre Jacke und ihre Geburtsurkunde. Im letzten Zugabteil machen sie eine überraschende Entdeckung: Die Platte einer Sitzbank ist defekt und lässt sich hochklappen. Kerstin, die nur 1,50 Meter groß und von zierlicher Statur ist, kann sich in dem Hohlraum darunter verstecken. Thomas und Carsten setzen sich ganz normal auf die Bänke.
Am Grenzübergang zur ČSSR in Bad Schandau kann Kerstin von ihrem Versteck aus hören, wie sich die Tür öffnet und ihre Freunde aufgefordert werden, mitzukommen. Kerstin ist nicht weiter beunruhigt, da sie vermutet, es handele sich um eine übliche Gepäckkontrolle. Sie schläft ein. Gegen fünf Uhr morgens erwacht sie und krabbelt aus ihrem Versteck heraus, da das Abteil verlassen scheint.
Kerstin stellt fest, dass sie in der ČSSR ist und macht sich auf die Suche nach Thomas und Carsten. Nach ein paar Stunden muss sie sich eingestehen, dass ihre Freunde wohl verhaftet worden sind. Kerstin braucht einen neuen Plan, denn allein will sie sich nicht über die grüne Grenze durchschlagen. Sie überlegt sich, die westdeutsche oder ostdeutsche Botschaft in Bratislava aufzusuchen. Eine mögliche Festnahme wertet sie als ersten Schritt in Richtung Freikauf.
»Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich am selben Tag an die Grenze und hätte mich wieder verhaften lassen. Also ich hätte das ganze Spiel so lange betrieben, bis man mich rausschmeißt. Ich war so stark auf diesem Weg, es gab für mich einfach kein Zurück mehr.«
Thomas und Carsten sind tatsächlich bei der Kontrolle in Bad Schandau verhaftet worden. Während Kerstin noch unentdeckt im Zug sitzt, vernehmen MfS-Beamten die jungen Männer unermüdlich in der Untersuchungshaftanstalt in der Bautzner Straße in Dresden. Weil die Freunde Kerstins Verbleib nicht preisgeben wollen, wenden die MfS-Beamten Manipulationstechniken an, um Thomas und Carsten unter Druck zu setzen. Ihre Vernehmer behaupten, der Zug würde über Wochen auf Abstellgleisen stehen und sollte Kerstin an Bord sein, so verdurste und verhungere sie darin. Daraufhin geben die Freunde Kerstins Verbleib preis.
»Ich möchte betonen, dass ich das nicht als Verrat empfand. Es war ja unser Plan, ins Gefängnis zu gehen und freigekauft zu werden.«
Als der Zug Brèclav erreicht, wird Kerstin von hochbewaffneten Polizeibeamten festgenommen und ins lokale Polizeigefängnis gebracht. Nicht nur aufgrund der Einzelhaft fühlt sich Kerstin isoliert, auch die Sprachbarriere erschwert die Kommunikation mit den tschechischen Wachbeamten. Die hygienischen Bedingungen ihrer Zelle sind schlecht: Kerstin kann sich zwei Wochen lang nicht die Zähne putzen und trägt auch Tag und Nacht ihre Kleidung. Wasser gibt es nur kaltes, und zwar aus demselben Hahn, der auch die Toilette spült. Die 19-Jährige friert stark, obwohl es schon Mitte April ist. In ihrer Not wäscht sie sich regelmäßig ihre Füße mit kaltem Wasser, um die Durchblutung anzuregen.
»Vor dem Fenster sah ich Frauen Wäsche aufhängen und dachte mir, was würde ich dafür geben, jetzt solche normalen Tätigkeiten zu machen. Da verstand ich das erste Mal, was Freiheit eigentlich bedeutet.«
Die Eintönigkeit der langen Tage in der Zelle wird nur durch die Vernehmungen durchbrochen. Mit der Drohung, sie wegen Republikflucht zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen, kann man sie nicht einschüchtern. Kerstin gesteht ihre Fluchtpläne offen ein.
»Ich war natürlich traurig, entsetzt und habe auch viel geheult, also es war nicht so cool, wie das jetzt rüberkommt. Trotzdem war für mich der Weg klar.«
Zwei Wochen später wird Kerstin per Flugzeug in die DDR überführt. Die erste Station ist die Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen. 1951 übernimmt das MfS das weiträumige Militärsperrgebiet vom NKWD/MWD, das dort von 1945 bis 1946 das sowjetische Speziallager Nr. 3 und von 1947 bis 1951 eine zentrale Untersuchungshaftanstalt betrieb. Wie der Vorgänger nutzt das MfS die Haftzellen im Keller. Sie sind fensterlos, bunkerartig, kaum belüftet und unbeheizt. Die Inhaftierten nennen den Hafttrakt deshalb das »U-Boot«. Später gibt es einen Gefängnisneubau. Bis Januar 1990 werden im Hohenschönhausener Gefängnis rund 11.000 Menschen aus politischen Gründen eingesperrt, seit dem Mauerbau sind das überwiegend die sogenannten Republikflüchtlinge wie Kerstin.
Kerstin muss sich nackt ausziehen und alle Körperöffnungen untersuchen lassen.
»Fand ich sehr, sehr unangenehm. Gleichzeitig dachte ich mir: Leute, ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich werde wohl kaum ein Maschinengewehr in mir tragen. Also ich fand das einerseits einschüchternd, aber andererseits auch lächerlich. Der Staat hatte solche Angst vor oppositionellen Menschen, davor, dass die irrsinnige Sachen machen.«

Das Porträt, das bei Kerstins Aufnahme in die MfS-UHA gemacht wird, 1983
Noch am selben Tag wird Kerstin in die MfS-Untersuchungshaftanstalt in Potsdam überführt, die inmitten der Innenstadt in einem Gefängnis aus dem Jahr 1910 untergebracht ist. Der historische Straßenname »Lindenstraße« sorgt für ihren Spottnamen »Lindenhotel«. Schon ab dem Jahr 1933 ist sie ein Ort politischer Verfolgung. Die NS-Diktatur inhaftiert hier politische Gegner und ausländische Zwangsarbeiter und verfügt mit dem ansässigen »Erbgesundheitsgericht« über die Zwangssterilisation von mehr als 3.300 Menschen. Nach Kriegsende 1945 sind in dem Gebäude das zentrale Untersuchungsgefängnis des NKWD/MWD in Brandenburg und ein Sowjetisches Militärtribunal untergebracht. Ab Sommer 1952 unterhält das MfS im Potsdamer Gefängnis eine Untersuchungshaftanstalt und inhaftiert bis Dezember 1989 mehr als 5.500 Menschen.
Die Haftumstände sind hier etwas besser. Kerstin bekommt saubere Anstaltskleidung, eine Zahnbürste und darf warm duschen. Ab jetzt darf sie auch ihrer Mutter einmal im Monat schreiben. Für Kerstins Mutter ist es enorm schwer, Kerstins Weg zu akzeptieren.
»Es war sehr hart für sie, aber es war richtig für mich. Ich musste raus aus diesem Strudel. Irgendwann trug sie die Lösung mit mir und blieb an meiner Seite. Wir hatten doch ein gutes und inniges Verhältnis miteinander.«
Auch in dieser UHA ist Kerstin in den Vernehmungen offen und ehrlich über ihre Absichten, freigekauft werden zu wollen. Ihr Vernehmer versucht, ihr das Leben in der Bundesrepublik schlechtzureden, indem er von DDR-Bürgern erzählt, die nach der Übersiedlung in die Arbeits- und Obdachlosigkeit gefallen seien. Doch Kerstin lässt sich auf die Einschüchterungstaktik nicht ein.
Neben den Verhören passiert während der Untersuchungshaft in Potsdam nicht viel. Für Kerstin ist die Verpflichtung, ihre Zelle sauber zu halten, eine willkommene Abwechslung. Außerdem werden die Insassen täglich für eine halbe Stunde in die Freiluftzellen gesteckt, die es in vielen Untersuchungshaftanstalten des MfS gibt. Dabei handelt es sich um kleine, aber hohe Betonverschläge auf dem Gefängnishof, die oben vergittert sind – die sogenannten Tigerkäfige. Auf ihren Mauern patrouillieren bedrohlich die mit Maschinengewehren bewaffneten Wachposten.
In der UHA Lindenstraße lernt Kerstin auch das sogenannte Knast-Alphabet. Durch eine bestimmte Abfolge von Klopfzeichen kommunizieren die Häftlinge über die Zellenwände miteinander. Man tauscht sich über die Namen und die vorgeworfenen Vergehen der anderen Insassen aus. Die Insassen müssen achtsam sein, denn sie werden vom Wachpersonal regelmäßig kontrolliert.
» Wir mussten nachts die Hände auf die Decke tun und auf dem Rücken liegen, was mir sehr schwerfiel, weil ich eine Bauchschläferin bin. Aber auch daran gewöhnte ich mich. Es gehörte für mich zum Prozess: Das ist jetzt einfach so und das überstehst du schon. Ich fand das psychisch nicht sehr belastend.«
Im Juli 1983 findet die Gerichtsverhandlung vor dem Kreisgericht Potsdam-Land unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zu diesem Anlass wird Kerstin für einige Tage im Polizeigefängnis Priesterstraße/Bauhofstraße untergebracht. Das Gericht verurteilt Kerstin, Thomas und Carsten nach Paragraf 213 des Strafgesetzbuchs der DDR zu jeweils einem Jahr und fünf Monaten Strafvollzug.
Im August 1983 wird sie mit einem Barkas zur Justizvollzugsanstalt in der Leipziger Alfred-Kästner-Straße gebracht. Das Gefängnis ist eine Übergangsstation. Nach rund drei Wochen Aufenthalt überführt man die Strafgefangenen in die jeweils für sie vorgesehenen Strafvollzugseinrichtungen. Kerstins Mittäter werden nach Bautzen gebracht.
Sie selbst kommt in ein Frauengefängnis im nahegelegenen Markkleeberg. Diese Einrichtung ist ein Forschungsdesiderat und weitgehend unbekannt. Es handelt sich um das Haftarbeitskommando einer ortsansässigen Wäscherei. Die Adresse, die Kerstin während des Strafvollzugs dort in einem Brief verzeichnet, lautet »verlängerte Hohe Straße, 7113 Markkleeberg«.
Die Unterbringung der ausschließlich weiblichen Häftlinge erfolgt in einem simplen Gebäude. Kerstin erinnert sich an einen eingegitterten Bereich mit insgesamt vier oder sechs Zellen, die mit jeweils acht Personen belegt sind. Außerhalb der Schlafens- oder Arbeitszeiten sind die Zellentüren geöffnet, so dass die Frauen untereinander Kontakt aufnehmen können. In ihren Zellen stehen ihnen Fächer für die wenigen persönlichen Gegenstände bereit, Dinge, die sie in der Haft einkaufen oder durch Pakete von Verwandten erhalten. Außerdem gibt es einen großen Tisch, an dem die Zelleninsassinnen gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen.
Etwa 70 bis 80 Prozent sind politisch Inhaftierte. Keine der Frauen ist älter als Mitte 20 und es herrscht ein gutes Miteinander ohne strenge Hierarchien. Kerstin freundet sich mit einer Zelleninsassin namens Maria an.
»Der Zusammenhalt war da, weil wir alle fühlten, irgendwie in einem Boot zu sitzen: Es ging um unsere Freilassung in den Westen. Deswegen war diese erzwungene Zweckgemeinschaft trotzdem sehr positiv.«
Der Haftalltag in Markkleeberg ist geregelt durch die Arbeit im Dreischichtsystem in der nahegelegenen Wäscherei. Dort müssen die Frauen große Waschmaschinen bedienen und Laken oder Tischdecken durch Wäschemangeln ziehen. Arbeitsschutz gibt es nicht. Es ist für Kerstin aber in Ordnung, diese schwere Haftarbeit zu leisten, weil dadurch immerhin die Zeit gut vergeht.
Auch das Mithelfen bei der Essensausgabe ist eine Möglichkeit, der Langeweile zu entgehen. Die Verpflegung ist nicht besonders gut und Kerstin hat zudem den Eindruck, ihnen werde eine Substanz im Tee verabreicht, um die Libido zu unterdrücken.
So vergehen die Monate mit Schichtarbeit und streng geregeltem Tagesablauf, bis die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel anstehen. Am 24. Dezember dürfen die Häftlinge fernsehen. Der Esstisch in ihrer Zelle wird von einem kleinen Tannenbaum geschmückt. Außerdem ist es ihnen gestattet, besondere Pakete zu erhalten.
In der Strafvollzugsanstalt arbeiten vorwiegend männliche Wachbeamte. Kerstin erinnert sich aber auch an die sogenannten Wachteln, das weibliche Wachpersonal. Eine darunter ist eine Oberleutnant, den die Häftlinge »Katze« nennen, weil sie die Fähigkeit besitzt, sich nahezu lautlos anzuschleichen und mit ihrer Anwesenheit zu überraschen. Ein Grund für Kerstin, immer genau zu hinterfragen, was sie laut sagt.
Auch wenn Kerstin den Umgang des Wachpersonals mit den Häftlingen als akzeptabel betrachtet, macht auch sie negative Erfahrungen, als sie und ihre Mithäftlinge sich gegenseitig mit Tinte aus einem Kugelschreiber tätowieren. Zur Strafe darf sie keinen Besuch empfangen.
»Meine Mutter durfte mich zweimal nicht besuchen, weil ich irgendwas angestellt hatte. Und was ich perfide fand, die ließen sie von Potsdam nach Leipzig fahren, um ihr das dann vor Ort zu sagen. Fand ich einfach unfair.«
Im Januar 1984 beschließt Kerstin, sich bei den DDR-Behörden in Erinnerung zu rufen, und stellt einen Ausreiseantrag. Darin schreibt sie: »Sollte diesem Wunsch nicht nachgegeben werden, möchte ich gleich bekanntgeben, daß ich heute schon weiß, daß ich aus diesem Grunde noch einmal straffällig werde und alle mir gegeben Möglichkeiten nutzen werde, um die DDR zu verlassen.«
Weil sie keine Reaktion auf ihren ersten Ausreiseantrag erhält, formuliert Kerstin im März 1984 ein zweites Schreiben, das sie erneut Oberleutnant »Katze« übergibt, mit der Bitte, es in ihre Haftakte zu legen. Die »Katze« antwortet ihr, das könne sie nicht, denn die Akte sei schon in Berlin. Kerstin wird hellhörig. Ihr steht eigentlich noch ein halbes Jahr Haftzeit bevor. Weil immer wieder Frauen vorzeitig abgeholt werden, über deren Verbleib spekuliert wird, reimt Kerstin sich nun zusammen, dass ihr Freikauf wohlmöglich im Gange ist.
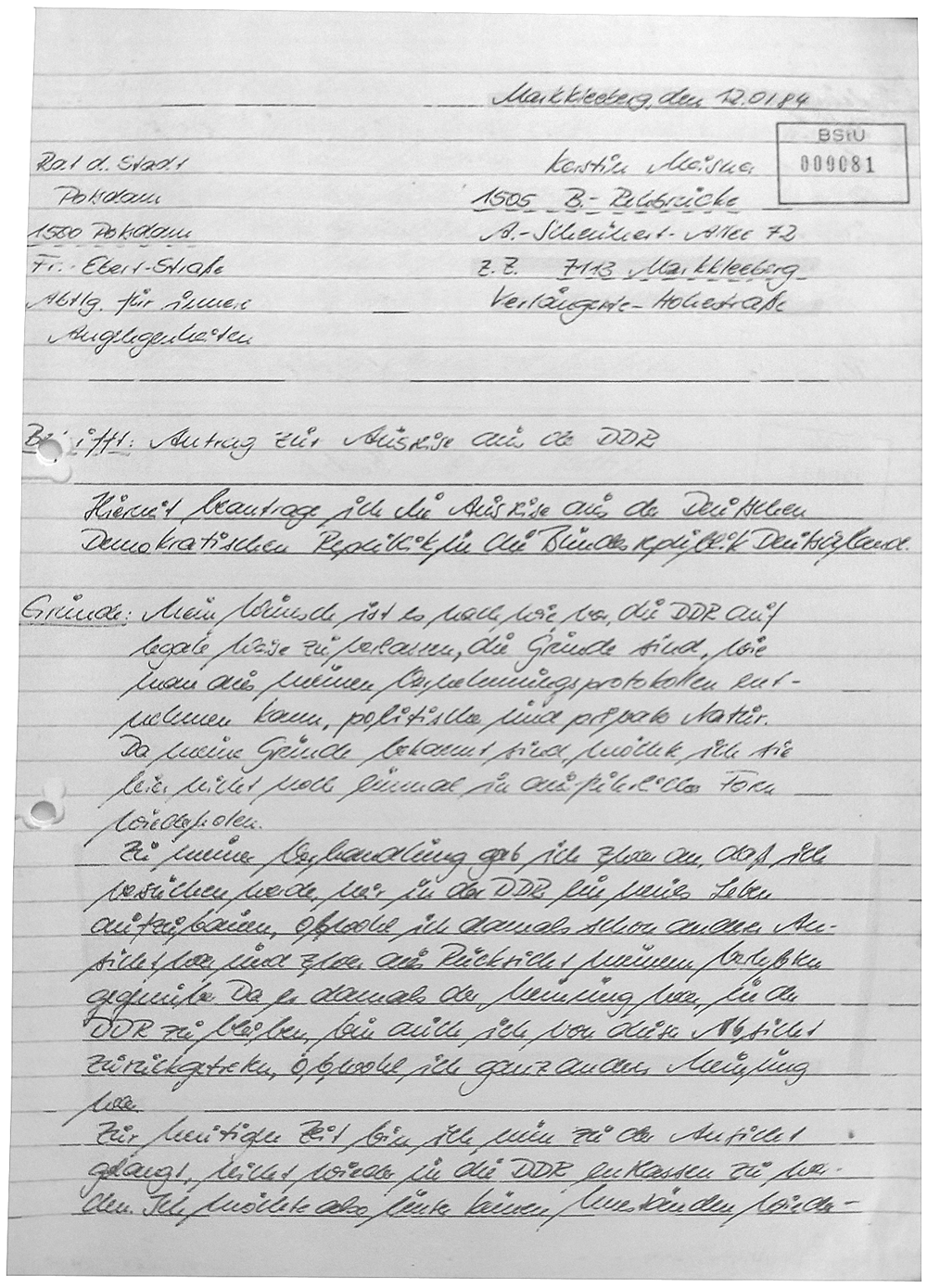
Kerstins erster Ausreiseantrag vom 12. Januar 1984
Eines Morgens im April 1984, als sie gerade zur Frühschicht ausrücken, werden Kerstin und ihre Haftkameradin Maria von der Wachhabenden aufgefordert, herauszutreten. Im ersten Moment befürchten die Freundinnen Übles und überlegen, wofür sie wohl bestraft werden. Doch als sie ihre Sachen packen sollen, sind sie sicher, dass nun die Verlegung in die »Abschiebehaft« ansteht. Auch hiervon haben sie bereits gehört.
Sie werden zur MfS-Untersuchungshaftanstalt am östlichen Rand des Kaßbergs in Karl-Marx-Stadt gefahren. Auch das sogenannte Kaßberg-Gefängnis ist schon seit der nationalsozialistischen Diktatur und während der sowjetischen Besatzungszeit für tausende politische Häftlinge eine der ersten Stationen auf dem langen Leidensweg durch Internierungslager, Strafvollzugsanstalten oder in den Tod. 1952 übernehmen die DDR-Behörden das Kaßberg-Gefängnis: das MdI nutzt den D-Flügel, im A-, B- und C-Flügel sperrt das MfS politisch Verfolgte ein.
Als größte der insgesamt 17 MfS-Untersuchungshaftanstalten und aufgrund seiner Nähe zur innerdeutschen Grenze wird das Kaßberg-Gefängnis ab Mitte der 1960er-Jahre zur zentralen Drehscheibe des deutsch-deutschen Häftlingsfreikaufs. Fast 90 Prozent der 33.755 Freigekauften werden von hier aus in die Bundesrepublik entlassen. Zwischen 1963 und 1989 bezahlt die Bundesrepublik im Rahmen des Häftlingsfreikaufs insgesamt rund 3,5 Milliarden D-Mark an die DDR.
Kerstin und Maria kommen für etwa zwei Wochen gemeinsam mit zwei weiteren Frauen in eine Zelle. Dort stehen zwei Doppelstockbetten und ein Schrank. Für die Freikaufhäftlinge herrscht eine andere Atmosphäre als in anderen DDR-Gefängnissen. Die Verpflegung ist besser, wenn auch nicht gut. Die Wachbeamten behandeln sie freundlicher.
»Wir Häftlinge hatten uns natürlich wahnsinnig viel zu erzählen und nahmen durch die Zellentür auch Kontakt mit anderen auf, und so wusste ich, dass Thomas und Carsten auch da sind.«
Die einzelnen Schritte des Freikaufverfahrens werden den Häftlingen nie im Vorhinein mitgeteilt, sondern immer nur kurz bevor sie stattfinden. So bleibt es für Kerstin bis zum Ende der Haftzeit eine tägliche Überraschung, ob sie zur Vernehmung, zum Gespräch mit dem Anwalt oder wie jetzt zum Notar abgeholt wird, um mit diesem den Verbleib ihrer Besitztümer zu regeln. Abschließend erhält sie einen Haftentlassungsschein sowie eine Urkunde über ihre Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR.
Kerstins Ausreisetag fällt auf den 26. April 1984. An diesem Morgen wird sie zu den sogenannten Effekten geführt, also dem Ort, wo die privaten Sachen der Häftlinge eingelagert werden. Sie erhält ihren Schmuck und die Kleidung wieder und stellt fest, dass sie während ihrer Haftzeit rund zehn Kilo zugenommen hat und nicht mehr in die Hose passt, die sie trug, als sie inhaftiert wurde.
»Die Wachhabende sagte zu mir: »Ja, Meisner, dann müssen Sie halt hierbleiben.« Da sagte ich: »Und wenn ich nackt über die Grenze krauche, das ist mir egal, aber ich bleibe nicht hier.«
Kurzerhand trennt Kerstin die doppelte Naht auf, denn ihre Hose war ohnehin enger eingenäht und kann problemlos wieder erweitert werden. Der Abtransport der ehemaligen Häftlinge erfolgt mit zwei Bussen. Nach dem Grenzübergang in Marienborn ist der Jubel unter den Insassen groß.
Kerstin verspürt ein großes Freiheitsgefühl. Im zentralen Notaufnahmelager Gießen wickelt man die rechtliche und soziale Eingliederung der ehemaligen DDR-Bürger ab. Sie werden mit Kleidung und Essen versorgt und bekommen 250 DM.
»Das erste Geld gab ich wirklich für Bananen aus. Und für Pommes mit Ketchup in einer Tüte.«
Mit Thomas, der auch freigekauft wurde, geht Kerstin nach West-Berlin. In diesem ersten halben Jahr werden sie von den bundesdeutschen Ämtern mit Krankengeld und Arbeitslosengeld versorgt. Sie müssen etliche behördliche Stationen ablaufen, um als Bundesbürger anerkannt und integriert zu werden.
Im Sommer 1984 trennt sich Kerstin von Thomas, weil er auf die schiefe Bahn gerät. Sie macht eine Ausbildung zur Stenokontoristin und findet eine Anstellung als Sekretärin, reist viel und genießt ihre Freiheit.
»In Berlin fing ich an, mich sehr links zu entwickeln – die wirklich linke Szene. Nicht die SED-linke Szene, das war ja eine Autokraten-Diktatur und hatte mit linker freier Szene nicht wirklich was zu tun. Das wurde immer propagandiert, stimmte aber nicht.«
Mit der DDR beschäftigt sich Kerstin in den kommenden Jahren wenig. Sie ist mit ihrem neuen Leben in Berlin beschäftigt. Der Mauerfall am 9. November 1989 ist für sie eine Überraschung.
1990 zieht Kerstin mit ihrem Partner nach Nürnberg. Dort einen neuen Freundeskreis aufzubauen, fällt ihr schwer. Die Mentalität der Franken ist weniger offen, als sie es von Berlinern oder Brandenburgern gewohnt ist.
Von 2005 bis 2014 lebt und arbeitet Kerstin in Indien. Sie genießt die Kultur, geprägt durch drei große Religionen und starke Traditionen – aber auch starke Kontraste zwischen Arm und Reich. Problematisch ist für sie die unfreie Rolle der Frau und das Kastensystem. Schließlich trifft Kerstin die Entscheidung, ihren indischen Freund zu verlassen und ihn für die Hochzeit mit einer anderen Frau freizugeben.
»Weil ich das, wofür ich 30 Jahre vorher gekämpft hatte, nicht wegen eines Mannes aufgeben konnte.«
Kerstin kehrt zurück nach Nürnberg. Mehr und mehr engagiert sie sich politisch. 2019 tritt sie dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei und wird in diversen Vorständen sowie Arbeitskreisen aktiv.
»Ich mache das, was ich will, das ist mein Leben. Ich merke immer wieder, dass ich mich bewusst in Situationen begebe, in denen ich rebelliere, anstatt mich zufrieden zurückzulehnen und mir vielleicht ein Haus zu nehmen mit Miezekatze und Garten.«
Kerstin beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Sozialisierung und Multi-Kulti, Feminismus und Diversität. Sie engagiert sich besonders für Demokratie und geschichtliche Aufarbeitung. Als Zeitzeugin berichtet Kerstin in den heutigen Gedenkstätten ihrer ehemaligen Haftorte regelmäßig in Interviews und vor allem vor Schulklassen in Bayern von ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
Kerstins Hafterlebnisse haben bei ihr keine negativen Spuren hinterlassen. Zwar ist ihr aufgefallen, dass sie große, helle Räume bevorzugt und ganz bewusst Türen offenstehen lässt. Doch Kerstin sagt von sich selbst, gestärkt und selbstbewusst aus der Situation herausgegangen zu sein. Sie hat erkannt, wie viel Kraft in ihrer Überzeugung und ihrem Willen stecken. Mit Veränderungen und Rückschlägen kann sie gut umgehen.
»Die Coronazeit war keine Diktatur und auch heute bewegen wir uns nicht in einer Diktatur. Leute, die das sagen, wissen einfach nicht, wovon sie reden. Es ist sicherlich keine Freiheit, mit 200 über die Autobahn zu rasen. Hier sitzen zu dürfen und mich mit dir über meine Geschichte unterhalten zu dürfen, oder damit in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist für mich Freiheit.«

»Ich hätte das ganze Spiel so lange mitgemacht, bis ich aus der DDR rausgekommen wäre.«
Kerstin Meisner wird am 13. Januar 1964 in Potsdam-Babelsberg geboren und wächst bei Dessau auf. 1973 zieht sie mit ihrer Mutter wieder zurück nach Potsdam, dort heiratet ihre Mutter ein zweites Mal. Kerstin ist eine fleißige Schülerin, sportlich aktiv und hat einen guten Freundeskreis, der ihr Ablenkung und vor allem den Halt gibt, den sie in ihrer Familie nicht bekommt. Ihre Mutter sowie ihr Großvater sind depressiv, tabletten- und alkoholabhängig.
»Ich fing innerlich langsam an, mich von meiner Mutter zu lösen, weil ich mit dieser Situation nicht klarkam.«
Beim Erwachsenwerden setzt sich Kerstin auch mehr und mehr mit ihrem Umfeld auseinander. In Potsdam ist es möglich, Fernsehprogramme aus der Bundesrepublik Deutschland zu empfangen. Sie schaut im Westfernsehen Sendungen wie »Monitor« oder »Report München« und schärft ihren Blick für den deutlichen Unterschied zwischen der ostdeutschen Propaganda und ihrer Lebensrealität, die unter der Mangelwirtschaft und der Diktatur leidet.
»Ich wunderte mich immer: »Die Planerfüllung liegt bei 100 Prozent, und wieder 150 Prozent, und alles ist toll.« Aber es war weiß Gott nicht alles super. Die Häuser verfielen, die Straßen verfielen. Wenn Brot mittags alle war, war das Brot halt alle, Punkt.«
Angesichts der offensichtlichen Unstimmigkeiten macht sich ein wachsendes Unwohlsein in Kerstin breit. Sie stellt ihre unbequemen Fragen im Staatsbürgerkundeunterricht. In der Folge fallen ihre Zeugnisse schlechter aus – nicht im Bereich der fachlichen Leistungen, doch bei den sogenannten Kopfnoten Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung, die im Schulsystem der DDR das Arbeits- und Sozialverhalten der Kinder bewerten sollen.
»Ich wollte auch nicht zu den Pionieren, das lehnte ich alles ab. Ab dem Jugendalter fand ich diese Ideologie einfach nur noch falsch. Ich fand nur den Zusammenhalt gut, und dass wir viel in der Freizeit machten.«
Kerstin darf nach der zehnten Klasse nicht auf die Erweiterte Oberschule (EOS) wechseln, um die Hochschulreife zu erlangen. Das Abitur wird in der DDR nur zehn Prozent eines Jahrgangs gewährt, in der Regel Schülerinnen und Schüler mit einem sehr guten Notendurchschnitt sowie einer politischen Einstellung und sozialen Herkunft, die im Sinne des Staates sind. Auf Rat ihres Vaters macht Kerstin eine Berufsausbildung – nicht in ihrem Wunschberuf, doch sie hat nicht viele Möglichkeiten.
»Ich wollte Drucker und Setzerin werden, wurde aber abgelehnt wegen meiner schlechten Noten. Dann wollte ich Kfz-Mechanikerin werden, dafür war ich zu klein. Für Tankwart war ich auch zu klein, und eine Frau, und zu schwach. Aber ich wollte nicht ins Büro. Zum Schluss landete ich dann in einer Brauerei als Facharbeiter für Anlagentechnik.«
Am Beginn der Berufsausbildung lernt Kerstin Thomas kennen und lieben. Das Paar eint unter anderem, dass sich beide gleichermaßen im System nicht aufgehoben und im Elternhaus unverstanden fühlen. Während Kerstin unter dem Alkoholismus ihrer Mutter leidet, lehnt Thomas die politische Meinung seiner Eltern, die überzeugte SED-Parteimitglieder sind, ab.
Mit einem Freund, Carsten, teilen Kerstin und Thomas politische Ideale und sehnen sich nach Meinungsfreiheit, Demokratie und weniger Reglementierungen. Die Reisefreiheit ist den Jugendlichen nicht so wichtig, doch Demokratie und Umweltpolitik ein großes Thema – und gleichzeitig eins, das in der DDR totgeschwiegen wird. Kerstin hat in Dessau oft gesehen, wie die Mulde durch die eingeleiteten Giftstoffe des Chemiekombinats Bitterfeld Schaumkronen trägt. Sie wünscht sich Veränderung und einen offenen Diskurs. Die Umweltpolitik und vor allem die progressive und unkonventionelle Art der Grünen Partei in der Bundesrepublik inspirieren Kerstin.
In ihrem Umfeld spürt Kerstin eine Zeit des Aufbruchs, des Aufbegehrens. Die Jugendlichen wollen nicht das System ändern – sie wissen auch gar nicht, wie. Aber sie lehnen ihr Leben in der DDR und ihre Familien ab und wollen ein neues Leben beginnen.
»Dann wurde der Gedanke geboren, in den Westteil des Landes zu gehen.«
Ab dem Spätsommer 1982 verfolgen die Freunde verschiedene Ideen, wie sie die DDR verlassen könnten. Sie schauen sich die Grenzanlagen an.
»Tod durch Erschießen war nicht unser Ziel. Also hat sich relativ schnell rauskristallisiert, es wird weder Berlin noch die westdeutsche Grenze, weil das viel zu sehr gesichert ist. Wir wussten von den Selbstschussanlagen, von den Minen, von dem ewig breiten Streifen, auf dem man sogar jede Spur eines Vogels sah, und dass es Hunde, dass es Patrouillen gab.«
Die Freunde ziehen auch nicht in Betracht, einen Antrag auf ständige Ausreise aus der DDR zu stellen. Dieses Ersuchen ermöglicht zwar über 400.000 Personen ein neues Leben in der Bundesrepublik. Gesetzlich ist eine Ausreise aus der DDR aber nicht vorgesehen und gilt als inakzeptable Absage an den Staat. Antragsteller müssen oft langwierige und harte Schikanen auf persönlicher, familiärer und beruflicher Ebene ertragen.

Kerstin zu Anfang der 1980er Jahre
Die 19-jährige Kerstin will eine schnelle Lösung. Sie möchte einen Fluchtversuch, der ungefährlich ist – der allerdings nicht erfolgreich sein muss. Die Freunde nehmen billigend in Kauf, den Weg über die Verhaftung und den Häftlingsfreikauf zu gehen. Dass die Bundesrepublik politische Häftlinge freikauft, ist ihnen bekannt.
»Die DDR war ja chronisch pleite. Man kann es modernen Menschenhandel nennen, war uns relativ egal.«
Der geplante Fluchtversuch soll über die damalige Tschechoslowakische Sozialistische Republik (ČSSR) erfolgen. Bei Bratislava wollen die Freunde nach Österreich und von hier aus wiederum nach Bayern fahren. Kerstin plant, sich im Zug auf dem Klo zu verstecken, weil sie ihren Ausweis verloren hat.
»Uns war klar, dass unser Fluchtversuch zu 80 Prozent nicht funktionieren wird. Dass wir ins Gefängnis gehen werden, dass sie uns erwischen werden. Deswegen haben wir uns gar nicht so viele Gedanken gemacht.«
Am 12. April 1983 besteigen Carsten, Thomas und Kerstin in Berlin-Schönefeld einen Fernzug in Richtung Bratislava. Kerstin hat nicht mehr dabei als ihre Jacke und ihre Geburtsurkunde. Im letzten Zugabteil machen sie eine überraschende Entdeckung: Die Platte einer Sitzbank ist defekt und lässt sich hochklappen. Kerstin, die nur 1,50 Meter groß und von zierlicher Statur ist, kann sich in dem Hohlraum darunter verstecken. Thomas und Carsten setzen sich ganz normal auf die Bänke.
Am Grenzübergang zur ČSSR in Bad Schandau kann Kerstin von ihrem Versteck aus hören, wie sich die Tür öffnet und ihre Freunde aufgefordert werden, mitzukommen. Kerstin ist nicht weiter beunruhigt, da sie vermutet, es handele sich um eine übliche Gepäckkontrolle. Sie schläft ein. Gegen fünf Uhr morgens erwacht sie und krabbelt aus ihrem Versteck heraus, da das Abteil verlassen scheint.
Kerstin stellt fest, dass sie in der ČSSR ist und macht sich auf die Suche nach Thomas und Carsten. Nach ein paar Stunden muss sie sich eingestehen, dass ihre Freunde wohl verhaftet worden sind. Kerstin braucht einen neuen Plan, denn allein will sie sich nicht über die grüne Grenze durchschlagen. Sie überlegt sich, die westdeutsche oder ostdeutsche Botschaft in Bratislava aufzusuchen. Eine mögliche Festnahme wertet sie als ersten Schritt in Richtung Freikauf.
»Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich am selben Tag an die Grenze und hätte mich wieder verhaften lassen. Also ich hätte das ganze Spiel so lange betrieben, bis man mich rausschmeißt. Ich war so stark auf diesem Weg, es gab für mich einfach kein Zurück mehr.«
Thomas und Carsten sind tatsächlich bei der Kontrolle in Bad Schandau verhaftet worden. Während Kerstin noch unentdeckt im Zug sitzt, vernehmen MfS-Beamten die jungen Männer unermüdlich in der Untersuchungshaftanstalt in der Bautzner Straße in Dresden. Weil die Freunde Kerstins Verbleib nicht preisgeben wollen, wenden die MfS-Beamten Manipulationstechniken an, um Thomas und Carsten unter Druck zu setzen. Ihre Vernehmer behaupten, der Zug würde über Wochen auf Abstellgleisen stehen und sollte Kerstin an Bord sein, so verdurste und verhungere sie darin. Daraufhin geben die Freunde Kerstins Verbleib preis.
»Ich möchte betonen, dass ich das nicht als Verrat empfand. Es war ja unser Plan, ins Gefängnis zu gehen und freigekauft zu werden.«
Als der Zug Brèclav erreicht, wird Kerstin von hochbewaffneten Polizeibeamten festgenommen und ins lokale Polizeigefängnis gebracht. Nicht nur aufgrund der Einzelhaft fühlt sich Kerstin isoliert, auch die Sprachbarriere erschwert die Kommunikation mit den tschechischen Wachbeamten. Die hygienischen Bedingungen ihrer Zelle sind schlecht: Kerstin kann sich zwei Wochen lang nicht die Zähne putzen und trägt auch Tag und Nacht ihre Kleidung. Wasser gibt es nur kaltes, und zwar aus demselben Hahn, der auch die Toilette spült. Die 19-Jährige friert stark, obwohl es schon Mitte April ist. In ihrer Not wäscht sie sich regelmäßig ihre Füße mit kaltem Wasser, um die Durchblutung anzuregen.
»Vor dem Fenster sah ich Frauen Wäsche aufhängen und dachte mir, was würde ich dafür geben, jetzt solche normalen Tätigkeiten zu machen. Da verstand ich das erste Mal, was Freiheit eigentlich bedeutet.«
Die Eintönigkeit der langen Tage in der Zelle wird nur durch die Vernehmungen durchbrochen. Mit der Drohung, sie wegen Republikflucht zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen, kann man sie nicht einschüchtern. Kerstin gesteht ihre Fluchtpläne offen ein.
»Ich war natürlich traurig, entsetzt und habe auch viel geheult, also es war nicht so cool, wie das jetzt rüberkommt. Trotzdem war für mich der Weg klar.«
Zwei Wochen später wird Kerstin per Flugzeug in die DDR überführt. Die erste Station ist die Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen. 1951 übernimmt das MfS das weiträumige Militärsperrgebiet vom NKWD/MWD, das dort von 1945 bis 1946 das sowjetische Speziallager Nr. 3 und von 1947 bis 1951 eine zentrale Untersuchungshaftanstalt betrieb. Wie der Vorgänger nutzt das MfS die Haftzellen im Keller. Sie sind fensterlos, bunkerartig, kaum belüftet und unbeheizt. Die Inhaftierten nennen den Hafttrakt deshalb das »U-Boot«. Später gibt es einen Gefängnisneubau. Bis Januar 1990 werden im Hohenschönhausener Gefängnis rund 11.000 Menschen aus politischen Gründen eingesperrt, seit dem Mauerbau sind das überwiegend die sogenannten Republikflüchtlinge wie Kerstin.
Kerstin muss sich nackt ausziehen und alle Körperöffnungen untersuchen lassen.
»Fand ich sehr, sehr unangenehm. Gleichzeitig dachte ich mir: Leute, ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich werde wohl kaum ein Maschinengewehr in mir tragen. Also ich fand das einerseits einschüchternd, aber andererseits auch lächerlich. Der Staat hatte solche Angst vor oppositionellen Menschen, davor, dass die irrsinnige Sachen machen.«

Das Porträt, das bei Kerstins Aufnahme in die MfS-UHA gemacht wird, 1983
Noch am selben Tag wird Kerstin in die MfS-Untersuchungshaftanstalt in Potsdam überführt, die inmitten der Innenstadt in einem Gefängnis aus dem Jahr 1910 untergebracht ist. Der historische Straßenname »Lindenstraße« sorgt für ihren Spottnamen »Lindenhotel«. Schon ab dem Jahr 1933 ist sie ein Ort politischer Verfolgung. Die NS-Diktatur inhaftiert hier politische Gegner und ausländische Zwangsarbeiter und verfügt mit dem ansässigen »Erbgesundheitsgericht« über die Zwangssterilisation von mehr als 3.300 Menschen. Nach Kriegsende 1945 sind in dem Gebäude das zentrale Untersuchungsgefängnis des NKWD/MWD in Brandenburg und ein Sowjetisches Militärtribunal untergebracht. Ab Sommer 1952 unterhält das MfS im Potsdamer Gefängnis eine Untersuchungshaftanstalt und inhaftiert bis Dezember 1989 mehr als 5.500 Menschen.
Die Haftumstände sind hier etwas besser. Kerstin bekommt saubere Anstaltskleidung, eine Zahnbürste und darf warm duschen. Ab jetzt darf sie auch ihrer Mutter einmal im Monat schreiben. Für Kerstins Mutter ist es enorm schwer, Kerstins Weg zu akzeptieren.
»Es war sehr hart für sie, aber es war richtig für mich. Ich musste raus aus diesem Strudel. Irgendwann trug sie die Lösung mit mir und blieb an meiner Seite. Wir hatten doch ein gutes und inniges Verhältnis miteinander.«
Auch in dieser UHA ist Kerstin in den Vernehmungen offen und ehrlich über ihre Absichten, freigekauft werden zu wollen. Ihr Vernehmer versucht, ihr das Leben in der Bundesrepublik schlechtzureden, indem er von DDR-Bürgern erzählt, die nach der Übersiedlung in die Arbeits- und Obdachlosigkeit gefallen seien. Doch Kerstin lässt sich auf die Einschüchterungstaktik nicht ein.
Neben den Verhören passiert während der Untersuchungshaft in Potsdam nicht viel. Für Kerstin ist die Verpflichtung, ihre Zelle sauber zu halten, eine willkommene Abwechslung. Außerdem werden die Insassen täglich für eine halbe Stunde in die Freiluftzellen gesteckt, die es in vielen Untersuchungshaftanstalten des MfS gibt. Dabei handelt es sich um kleine, aber hohe Betonverschläge auf dem Gefängnishof, die oben vergittert sind – die sogenannten Tigerkäfige. Auf ihren Mauern patrouillieren bedrohlich die mit Maschinengewehren bewaffneten Wachposten.
In der UHA Lindenstraße lernt Kerstin auch das sogenannte Knast-Alphabet. Durch eine bestimmte Abfolge von Klopfzeichen kommunizieren die Häftlinge über die Zellenwände miteinander. Man tauscht sich über die Namen und die vorgeworfenen Vergehen der anderen Insassen aus. Die Insassen müssen achtsam sein, denn sie werden vom Wachpersonal regelmäßig kontrolliert.
» Wir mussten nachts die Hände auf die Decke tun und auf dem Rücken liegen, was mir sehr schwerfiel, weil ich eine Bauchschläferin bin. Aber auch daran gewöhnte ich mich. Es gehörte für mich zum Prozess: Das ist jetzt einfach so und das überstehst du schon. Ich fand das psychisch nicht sehr belastend.«
Im Juli 1983 findet die Gerichtsverhandlung vor dem Kreisgericht Potsdam-Land unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zu diesem Anlass wird Kerstin für einige Tage im Polizeigefängnis Priesterstraße/Bauhofstraße untergebracht. Das Gericht verurteilt Kerstin, Thomas und Carsten nach Paragraf 213 des Strafgesetzbuchs der DDR zu jeweils einem Jahr und fünf Monaten Strafvollzug.
Im August 1983 wird sie mit einem Barkas zur Justizvollzugsanstalt in der Leipziger Alfred-Kästner-Straße gebracht. Das Gefängnis ist eine Übergangsstation. Nach rund drei Wochen Aufenthalt überführt man die Strafgefangenen in die jeweils für sie vorgesehenen Strafvollzugseinrichtungen. Kerstins Mittäter werden nach Bautzen gebracht.
Sie selbst kommt in ein Frauengefängnis im nahegelegenen Markkleeberg. Diese Einrichtung ist ein Forschungsdesiderat und weitgehend unbekannt. Es handelt sich um das Haftarbeitskommando einer ortsansässigen Wäscherei. Die Adresse, die Kerstin während des Strafvollzugs dort in einem Brief verzeichnet, lautet »verlängerte Hohe Straße, 7113 Markkleeberg«.
Die Unterbringung der ausschließlich weiblichen Häftlinge erfolgt in einem simplen Gebäude. Kerstin erinnert sich an einen eingegitterten Bereich mit insgesamt vier oder sechs Zellen, die mit jeweils acht Personen belegt sind. Außerhalb der Schlafens- oder Arbeitszeiten sind die Zellentüren geöffnet, so dass die Frauen untereinander Kontakt aufnehmen können. In ihren Zellen stehen ihnen Fächer für die wenigen persönlichen Gegenstände bereit, Dinge, die sie in der Haft einkaufen oder durch Pakete von Verwandten erhalten. Außerdem gibt es einen großen Tisch, an dem die Zelleninsassinnen gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen.
Etwa 70 bis 80 Prozent sind politisch Inhaftierte. Keine der Frauen ist älter als Mitte 20 und es herrscht ein gutes Miteinander ohne strenge Hierarchien. Kerstin freundet sich mit einer Zelleninsassin namens Maria an.
»Der Zusammenhalt war da, weil wir alle fühlten, irgendwie in einem Boot zu sitzen: Es ging um unsere Freilassung in den Westen. Deswegen war diese erzwungene Zweckgemeinschaft trotzdem sehr positiv.«
Der Haftalltag in Markkleeberg ist geregelt durch die Arbeit im Dreischichtsystem in der nahegelegenen Wäscherei. Dort müssen die Frauen große Waschmaschinen bedienen und Laken oder Tischdecken durch Wäschemangeln ziehen. Arbeitsschutz gibt es nicht. Es ist für Kerstin aber in Ordnung, diese schwere Haftarbeit zu leisten, weil dadurch immerhin die Zeit gut vergeht.
Auch das Mithelfen bei der Essensausgabe ist eine Möglichkeit, der Langeweile zu entgehen. Die Verpflegung ist nicht besonders gut und Kerstin hat zudem den Eindruck, ihnen werde eine Substanz im Tee verabreicht, um die Libido zu unterdrücken.
So vergehen die Monate mit Schichtarbeit und streng geregeltem Tagesablauf, bis die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel anstehen. Am 24. Dezember dürfen die Häftlinge fernsehen. Der Esstisch in ihrer Zelle wird von einem kleinen Tannenbaum geschmückt. Außerdem ist es ihnen gestattet, besondere Pakete zu erhalten.
In der Strafvollzugsanstalt arbeiten vorwiegend männliche Wachbeamte. Kerstin erinnert sich aber auch an die sogenannten Wachteln, das weibliche Wachpersonal. Eine darunter ist eine Oberleutnant, den die Häftlinge »Katze« nennen, weil sie die Fähigkeit besitzt, sich nahezu lautlos anzuschleichen und mit ihrer Anwesenheit zu überraschen. Ein Grund für Kerstin, immer genau zu hinterfragen, was sie laut sagt.
Auch wenn Kerstin den Umgang des Wachpersonals mit den Häftlingen als akzeptabel betrachtet, macht auch sie negative Erfahrungen, als sie und ihre Mithäftlinge sich gegenseitig mit Tinte aus einem Kugelschreiber tätowieren. Zur Strafe darf sie keinen Besuch empfangen.
»Meine Mutter durfte mich zweimal nicht besuchen, weil ich irgendwas angestellt hatte. Und was ich perfide fand, die ließen sie von Potsdam nach Leipzig fahren, um ihr das dann vor Ort zu sagen. Fand ich einfach unfair.«
Im Januar 1984 beschließt Kerstin, sich bei den DDR-Behörden in Erinnerung zu rufen, und stellt einen Ausreiseantrag. Darin schreibt sie: »Sollte diesem Wunsch nicht nachgegeben werden, möchte ich gleich bekanntgeben, daß ich heute schon weiß, daß ich aus diesem Grunde noch einmal straffällig werde und alle mir gegeben Möglichkeiten nutzen werde, um die DDR zu verlassen.«
Weil sie keine Reaktion auf ihren ersten Ausreiseantrag erhält, formuliert Kerstin im März 1984 ein zweites Schreiben, das sie erneut Oberleutnant »Katze« übergibt, mit der Bitte, es in ihre Haftakte zu legen. Die »Katze« antwortet ihr, das könne sie nicht, denn die Akte sei schon in Berlin. Kerstin wird hellhörig. Ihr steht eigentlich noch ein halbes Jahr Haftzeit bevor. Weil immer wieder Frauen vorzeitig abgeholt werden, über deren Verbleib spekuliert wird, reimt Kerstin sich nun zusammen, dass ihr Freikauf wohlmöglich im Gange ist.
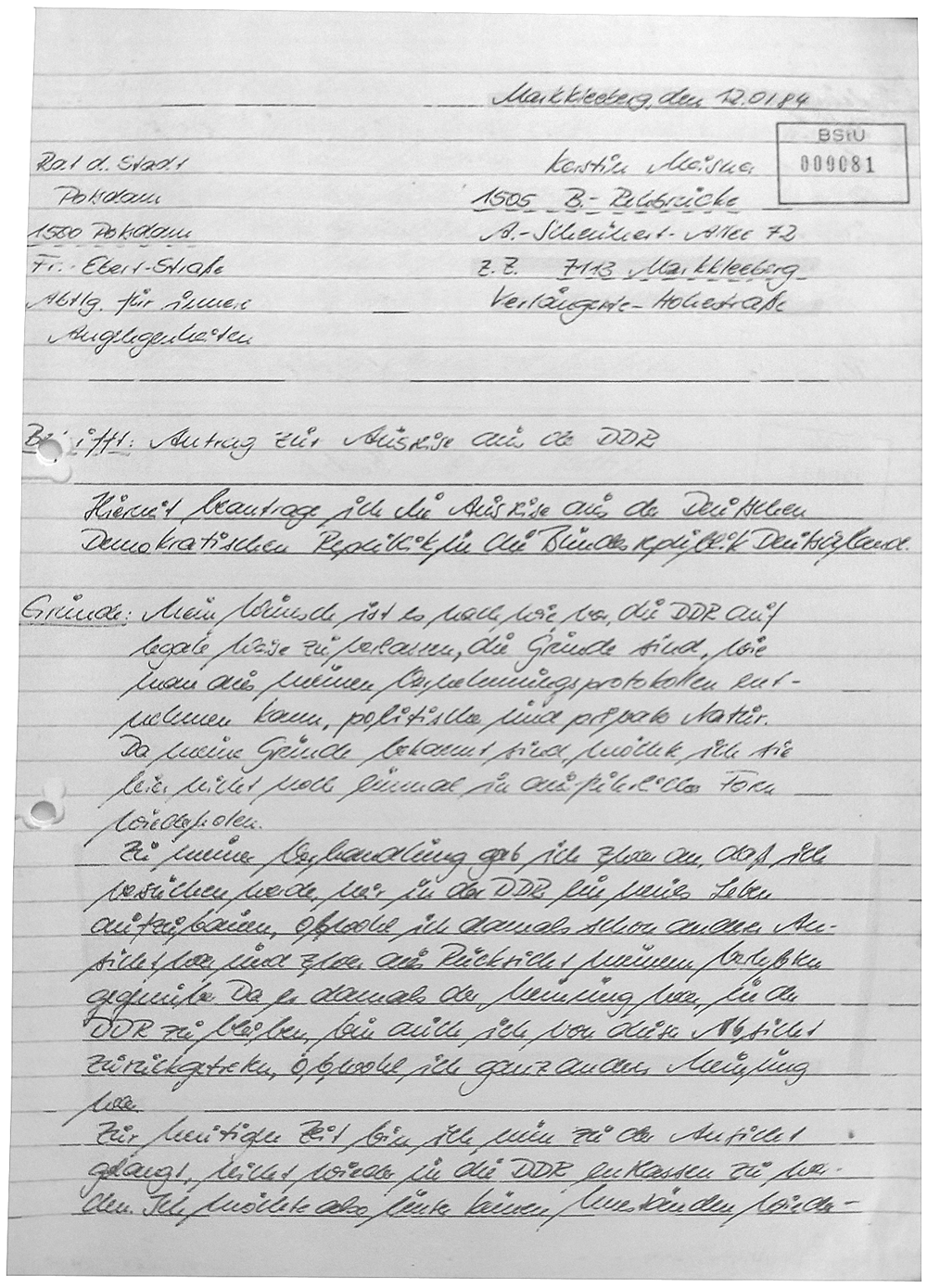
Kerstins erster Ausreiseantrag vom 12. Januar 1984
Eines Morgens im April 1984, als sie gerade zur Frühschicht ausrücken, werden Kerstin und ihre Haftkameradin Maria von der Wachhabenden aufgefordert, herauszutreten. Im ersten Moment befürchten die Freundinnen Übles und überlegen, wofür sie wohl bestraft werden. Doch als sie ihre Sachen packen sollen, sind sie sicher, dass nun die Verlegung in die »Abschiebehaft« ansteht. Auch hiervon haben sie bereits gehört.
Sie werden zur MfS-Untersuchungshaftanstalt am östlichen Rand des Kaßbergs in Karl-Marx-Stadt gefahren. Auch das sogenannte Kaßberg-Gefängnis ist schon seit der nationalsozialistischen Diktatur und während der sowjetischen Besatzungszeit für tausende politische Häftlinge eine der ersten Stationen auf dem langen Leidensweg durch Internierungslager, Strafvollzugsanstalten oder in den Tod. 1952 übernehmen die DDR-Behörden das Kaßberg-Gefängnis: das MdI nutzt den D-Flügel, im A-, B- und C-Flügel sperrt das MfS politisch Verfolgte ein.
Als größte der insgesamt 17 MfS-Untersuchungshaftanstalten und aufgrund seiner Nähe zur innerdeutschen Grenze wird das Kaßberg-Gefängnis ab Mitte der 1960er-Jahre zur zentralen Drehscheibe des deutsch-deutschen Häftlingsfreikaufs. Fast 90 Prozent der 33.755 Freigekauften werden von hier aus in die Bundesrepublik entlassen. Zwischen 1963 und 1989 bezahlt die Bundesrepublik im Rahmen des Häftlingsfreikaufs insgesamt rund 3,5 Milliarden D-Mark an die DDR.
Kerstin und Maria kommen für etwa zwei Wochen gemeinsam mit zwei weiteren Frauen in eine Zelle. Dort stehen zwei Doppelstockbetten und ein Schrank. Für die Freikaufhäftlinge herrscht eine andere Atmosphäre als in anderen DDR-Gefängnissen. Die Verpflegung ist besser, wenn auch nicht gut. Die Wachbeamten behandeln sie freundlicher.
»Wir Häftlinge hatten uns natürlich wahnsinnig viel zu erzählen und nahmen durch die Zellentür auch Kontakt mit anderen auf, und so wusste ich, dass Thomas und Carsten auch da sind.«
Die einzelnen Schritte des Freikaufverfahrens werden den Häftlingen nie im Vorhinein mitgeteilt, sondern immer nur kurz bevor sie stattfinden. So bleibt es für Kerstin bis zum Ende der Haftzeit eine tägliche Überraschung, ob sie zur Vernehmung, zum Gespräch mit dem Anwalt oder wie jetzt zum Notar abgeholt wird, um mit diesem den Verbleib ihrer Besitztümer zu regeln. Abschließend erhält sie einen Haftentlassungsschein sowie eine Urkunde über ihre Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR.
Kerstins Ausreisetag fällt auf den 26. April 1984. An diesem Morgen wird sie zu den sogenannten Effekten geführt, also dem Ort, wo die privaten Sachen der Häftlinge eingelagert werden. Sie erhält ihren Schmuck und die Kleidung wieder und stellt fest, dass sie während ihrer Haftzeit rund zehn Kilo zugenommen hat und nicht mehr in die Hose passt, die sie trug, als sie inhaftiert wurde.
»Die Wachhabende sagte zu mir: »Ja, Meisner, dann müssen Sie halt hierbleiben.« Da sagte ich: »Und wenn ich nackt über die Grenze krauche, das ist mir egal, aber ich bleibe nicht hier.«
Kurzerhand trennt Kerstin die doppelte Naht auf, denn ihre Hose war ohnehin enger eingenäht und kann problemlos wieder erweitert werden. Der Abtransport der ehemaligen Häftlinge erfolgt mit zwei Bussen. Nach dem Grenzübergang in Marienborn ist der Jubel unter den Insassen groß.
Kerstin verspürt ein großes Freiheitsgefühl. Im zentralen Notaufnahmelager Gießen wickelt man die rechtliche und soziale Eingliederung der ehemaligen DDR-Bürger ab. Sie werden mit Kleidung und Essen versorgt und bekommen 250 DM.
»Das erste Geld gab ich wirklich für Bananen aus. Und für Pommes mit Ketchup in einer Tüte.«
Mit Thomas, der auch freigekauft wurde, geht Kerstin nach West-Berlin. In diesem ersten halben Jahr werden sie von den bundesdeutschen Ämtern mit Krankengeld und Arbeitslosengeld versorgt. Sie müssen etliche behördliche Stationen ablaufen, um als Bundesbürger anerkannt und integriert zu werden.
Im Sommer 1984 trennt sich Kerstin von Thomas, weil er auf die schiefe Bahn gerät. Sie macht eine Ausbildung zur Stenokontoristin und findet eine Anstellung als Sekretärin, reist viel und genießt ihre Freiheit.
»In Berlin fing ich an, mich sehr links zu entwickeln – die wirklich linke Szene. Nicht die SED-linke Szene, das war ja eine Autokraten-Diktatur und hatte mit linker freier Szene nicht wirklich was zu tun. Das wurde immer propagandiert, stimmte aber nicht.«
Mit der DDR beschäftigt sich Kerstin in den kommenden Jahren wenig. Sie ist mit ihrem neuen Leben in Berlin beschäftigt. Der Mauerfall am 9. November 1989 ist für sie eine Überraschung.
1990 zieht Kerstin mit ihrem Partner nach Nürnberg. Dort einen neuen Freundeskreis aufzubauen, fällt ihr schwer. Die Mentalität der Franken ist weniger offen, als sie es von Berlinern oder Brandenburgern gewohnt ist.
Von 2005 bis 2014 lebt und arbeitet Kerstin in Indien. Sie genießt die Kultur, geprägt durch drei große Religionen und starke Traditionen – aber auch starke Kontraste zwischen Arm und Reich. Problematisch ist für sie die unfreie Rolle der Frau und das Kastensystem. Schließlich trifft Kerstin die Entscheidung, ihren indischen Freund zu verlassen und ihn für die Hochzeit mit einer anderen Frau freizugeben.
»Weil ich das, wofür ich 30 Jahre vorher gekämpft hatte, nicht wegen eines Mannes aufgeben konnte.«
Kerstin kehrt zurück nach Nürnberg. Mehr und mehr engagiert sie sich politisch. 2019 tritt sie dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei und wird in diversen Vorständen sowie Arbeitskreisen aktiv.
»Ich mache das, was ich will, das ist mein Leben. Ich merke immer wieder, dass ich mich bewusst in Situationen begebe, in denen ich rebelliere, anstatt mich zufrieden zurückzulehnen und mir vielleicht ein Haus zu nehmen mit Miezekatze und Garten.«
Kerstin beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Sozialisierung und Multi-Kulti, Feminismus und Diversität. Sie engagiert sich besonders für Demokratie und geschichtliche Aufarbeitung. Als Zeitzeugin berichtet Kerstin in den heutigen Gedenkstätten ihrer ehemaligen Haftorte regelmäßig in Interviews und vor allem vor Schulklassen in Bayern von ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
Kerstins Hafterlebnisse haben bei ihr keine negativen Spuren hinterlassen. Zwar ist ihr aufgefallen, dass sie große, helle Räume bevorzugt und ganz bewusst Türen offenstehen lässt. Doch Kerstin sagt von sich selbst, gestärkt und selbstbewusst aus der Situation herausgegangen zu sein. Sie hat erkannt, wie viel Kraft in ihrer Überzeugung und ihrem Willen stecken. Mit Veränderungen und Rückschlägen kann sie gut umgehen.
»Die Coronazeit war keine Diktatur und auch heute bewegen wir uns nicht in einer Diktatur. Leute, die das sagen, wissen einfach nicht, wovon sie reden. Es ist sicherlich keine Freiheit, mit 200 über die Autobahn zu rasen. Hier sitzen zu dürfen und mich mit dir über meine Geschichte unterhalten zu dürfen, oder damit in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist für mich Freiheit.«